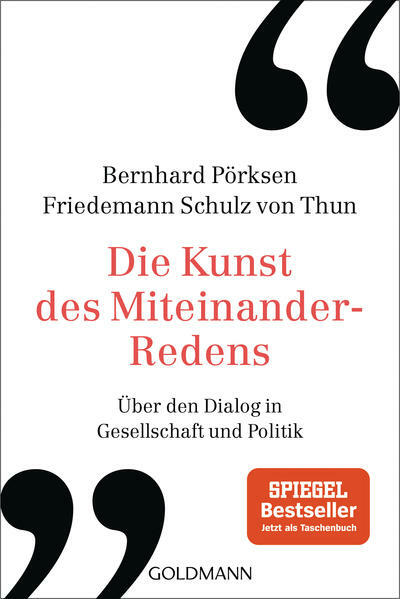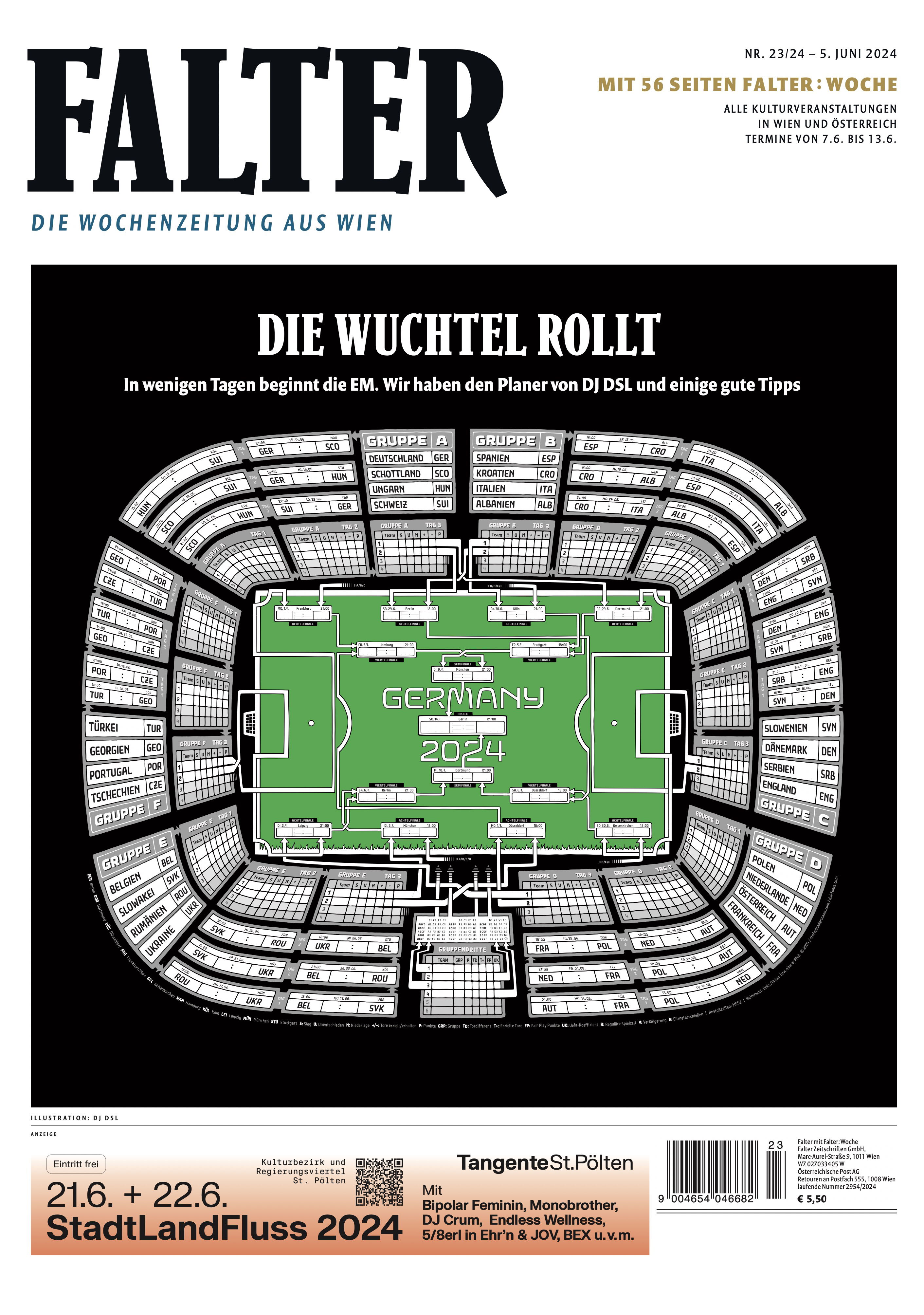
Schluss mit dem Empörungsspektakel!
Florian Klenk in FALTER 23/2024 vom 05.06.2024 (S. 21)
Faschistische Liedtexte singende Rich Kids in Sylt. Eine grüne EU-Spitzenkandidatin, deren Chats tagelang öffentlich seziert werden. Das sind nur zwei Phänomene in einer "dauergereizten" Social-Media-Mediengesellschaft. Wie muss sich der Qualitätsjournalismus von Mobbingspektakeln und Empörungshysterie abgrenzen? Wie muss er sich neu erfinden, um eine medienmüde Gesellschaft zu erreichen? Der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, bekannt geworden durch sein Buch über die durch das Netz erzeugte "große Gereiztheit" der Gesellschaft, plädiert für genaues Hinschauen.
Falter: Herr Professor Pörksen, Lokalbesucher auf Sylt grölen "Ausländer
raus"-Parolen und lösen in Deutschland seit einer Woche eine riesige Debatte aus, nicht nur über die Unterwanderung des Landes mit rechtsradikalen Ideen, sondern auch über die Meute im Netz. Ist das alles noch angemessen?
Bernhard Pörksen: Ich schwanke. Denn wir sehen ganz viel gleichzeitig: Empörungshysterie, ein Mobbingspektakel, Versuche der Selbstjustiz, betrieben von einer digitalen Normpolizei, die von der eigenen moralischen Überlegenheit berauscht ist. Und doch: Es gibt einige wenige Stimmen, die den zweiten Gedanken denken, die Aktualität hinter der Aktualität entdecken, um die es gehen könnte: die Alltäglichkeit des Rassismus, die große Leichtigkeit, mit der rassistisches Gegröle sich normalisiert -in Deutschland, in Österreich und anderswo.
Die Betroffenen werden nun entlarvt - gedoxt - und durchs Netz gejagt, wie im Mittelalter. Jene Frau, die sich beim "Ausländer raus"-Singen filmte, wurde sogar von der Uni suspendiert. Sind wir wieder bei der Rache angekommen?
Pörksen: Was sich hier zeigt, ist Symbolpolitik, virtue signaling. Sofort entlassen, marginalisieren, von der Uni werfen, aber dann zur Tagesordnung übergehen -das Motto: Die Gesinnungsshow reicht. Aber erneut: Verstehen Sie meine Gegenrede bitte als ein Plädoyer für Gewaltenteilung und für das Ideal des abwägenden, untersuchenden Urteils, ein Urprinzip von Demokratie. Denn auch ich finde: Das Parolengebrüll ist widerlich. Und doch: Jeder Mensch hat Persönlichkeitsrechte, auch die, die einem zuwider sind.
Bekommen Sie es da mit der Angst zu tun?
Pörksen: Angst ist es nicht. Eher Empörungsekel, Wutmüdigkeit, manchmal auch Ratlosigkeit, weil die Gesellschaft im Prozess der laufenden Kommunikationsrevolution so unendlich langsam lernt. Denn eigentlich liegt die große, nach wie vor gesellschaftspolitisch nicht entzifferte Bildungsaufgabe auf der Hand: Weil alle zu Sendern geworden sind, sollten die Ideale des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden. Was ist relevant, was öffentliches Interesse? Wen darf man unverpixelt zeigen? Was ist legitime Enthüllung, was illegale Menschenjagd? Diese Fragen gehen heute jeden an.
Sie haben den Begriff der "redaktionellen Gesellschaft" geprägt, also einer Gesellschaft, die über Social Media verbunden ist und sich permanent austauschen und theoretisch ein Millionenpublikum erreichen kann. Diese Gesellschaft und die sogenannte "fünfte Gewalt" können Menschen wegen vergleichsweise kleiner Vergehen auch in den Ruin oder gar Tod treiben. Hat der Staat mit seinem Gewaltmonopol ausgedient?
Pörksen: Im Gegenteil, auch wenn die Durchsetzung dieses Gewaltmonopols im Paralleluniversum der sozialen Netzwerke schwieriger wird. Eben deshalb ist es absolut zentral, das Ethos des Individuums, altmodisch formuliert: seine Herzensbildung, zu stärken. Und noch etwas. Die Prangermethode, das macht den aktuellen Fall so brisant, wird in Deutschland auch von Politikern empfohlen. Nur ein Beispiel: Armin Laschet, er wollte einmal Bundeskanzler werden, sagt öffentlich, ich zitiere: "In kürzester Zeit waren alle Namen öffentlich, sie haben alle ihren Job verloren. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir darauf achten, dass das bei all diesen Vorfällen gilt." Man sieht: Es ist nicht nur ein Netzmob, der hier über die Stränge schlägt. Hier regiert eine aufmerksamkeitsgierige Politik. Man spürt förmlich, wie hier jemand um Beachtung bettelt. Und dafür auch schon einmal elementare Prinzipien des Rechtsstaates und der Demokratie missachtet.
In Österreich erlebten wir zeitgleich den Fall Lena Schilling. Eine Frau wird aufgrund von Chats oder Videos, die sie privat oder zumindest nicht medienöffentlich schrieb, politisch infrage gestellt. Ist das die oft eingemahnte Transparenz oder eher ein Anschlag auf das Private?
Pörksen: Es ist, würde ich sagen, eine eigene Macht der Transparenz, die neuartige Schmerzen der Sichtbarkeit produziert. Alle erscheinen in einer grell überbelichteten Welt, in der fortwährend fiebrige Chats, Kungeleien, diffuse Anspielungen und echte Grenzüberschreitungen bekannt werden, total gewöhnlich, peinlich, machthungrig, bösartig. Man sieht: Autorität und Imagepolitik basieren auf gelingender Informationskontrolle. Und weil dies unter den aktuellen Medienbedingungen immer schwieriger wird, gerät die Enthüllung von Peinlichkeiten und echten Skandalen zum Dauerzustand.
Was folgt daraus?
Pörksen: Einschüchterung, Verdruckstheit, bloß taktisches Sprechen -auch wenn das Taktieren gar nicht auf Dauer und in jeder Lebenslage durchhaltbar ist, denn wir sind nun einmal aus "krummem Holz"."Handle stets so, dass dir die öffentlichen Effekte deines Handelns langfristig vertretbar erscheinen", so könnte man den kategorischen Imperativ des digitalen Zeitalters formulieren. "Aber rechne damit, dass dies nichts nützt."
Haben wir noch ein Recht auf "Kontext"? Oder müssen wir uns Kontextverletzungen gefallen lassen?
Pörksen: Empirisch ist der Kollaps der Kontexte längst mediale Realität. Wer hat noch nie eine E-Mail leider an den falschen Verteiler geschickt, im Affekt gepostet, sich in ungünstiger Pose auf einem Smartphone-Video wiederentdeckt? Normativ betrachtet ist die Sichtbarmachung von Kontexten hingegen konkrete Kommunikationsethik, Arbeit am Großprojekt der wechselseitigen Verständigung, des menschlichen Miteinanders.
Wie meinen Sie das?
Pörksen: Mein medientheoretisches Mantra lautet: Der Kontext ist die Botschaft. Ohne den Kontext sind wir existenziell verloren, denn Bedeutung und Sinn entstehen erst im Kontext. Ohne Kontext kann sich kein angemessenes Verstehen entwickeln, keine gelingende Kommunikation. Ohne Kontext können wir nicht zu einem gerechten Urteil gelangen. Und ohne Kontext können wir keine adäquate Position entwickeln.
Niemand kann mehr einschätzen, wie Mails, Chats und Videos, die wir posten, irgendwann aufschlagen. Wie sollen wir damit umgehen? Pörksen: Ich halte diese Möglichkeitsblindheit, wie ich das nenne, für ein letztlich unaufhebbares Faktum, das man nicht durch ein bisschen Medientraining korrigieren kann. Wir können uns die mögliche Zukunft unserer E-Mails, Chatnachrichten, Facebook-Postings prinzipiell nicht vorstellen. Dokumente der Blamage und Demontage sind -einmal digitalisiert -ungeheuer beweglich. Sie lassen sich rasch durchsuchen, kopieren, blitzschnell verbreiten, in immer neue Kontexte übertragen. Damit ist die Erfahrung des Kontrollverlustes programmiert.
Sie vertreten in Ihren Büchern die These, dass auch der klassische Journalismus im "Aktualitäts-Rausch" steckt, dass es einen "Kult der Kurzfristigkeit" gibt und wir -wie im Film "Dont look up" - nicht mehr auf große Fragen fokussieren. War das nicht immer schon die Logik der Massenmedien?
Pörksen: Ja, stimmt. Aber diese Grammatik der Massenmedien bzw. des politischen Journalismus mit seiner News-Fixierung, seinen Er-sagt-sie-sagt-Ritualen, seinem Interesse an Qualm, Konflikt und Machtspielen passt nicht mehr in die Zeit, davon bin ich überzeugt. Das waren Routinen für Schönwetterphasen. Und das sind deplatzierte, Ablenkung produzierende Spielregeln, wenn es um existenzielle Krisen - die Erosion von Demokratien, den Angriffskrieg Russlands, die Klimakrise -geht.
Aber: Was tun?
Pörksen: Es gilt, wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein gesagt hätte, darum, die ganze Betrachtung zu drehen. Und das heißt: weg von der zeitlich bestimmten Aktualität und hin zur existenziellen Relevanz, weg von der Fixierung auf Personen und hin zu programmatischen Lösungen. Es geht darum, ein Denken in der langen Linie zu praktizieren, den Weg in eine andere, bessere Zukunft neu vorstellbar zu machen, den konstruktiven Journalismus mit anderer Wucht zu versorgen. Ich nenne das Szenarienjournalismus -ein Berichterstattungsmuster, das es noch viel zu selten gibt.
Geht es konkret?
Pörksen: Ja. Politische Journalisten haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie sich transnational organisieren können; denken Sie an Panama Papers, die Enthüllung von Finanzkriminalität. Warum nicht dieses Muster -Kooperation in weltweiten Netzwerken -nutzen, um in Zeiten planetarischer Krisen Themen von allgemeiner Bedeutung auf die öffentliche Agenda zu setzen? Beispielsweise orientiert an der Frage: Wann ist der Automausstieg sinnvoll? Was braucht es für gelingende Impfkommunikation? Wie schafft man Krisenresilienz in Zeiten von Starkregen, gewaltiger Hitze? Ein solches Denken in Szenarien wäre eine Möglichkeit, die gefährliche Kurzatmigkeit der Politik zu korrigieren. Aber dafür braucht es den Adlerblick, das Lernen von anderen, den Abschied vom Neuigkeitsfetisch.
Immer mehr Politiker beklagen in Abschiedsinterviews, dieser Gewalttätigkeit des Medienzeitalters nicht mehr gewachsen zu sein. Hat dies Auswirkungen auf unsere politische Kultur?
Pörksen: Ja -und zwar auf dreifache Weise, nämlich durch medialen Druck, durch die opportunistische Selbstunterwerfung bzw. das Schielen auf Aufmerksamkeitseffekte vonseiten der politischen Player und durch das Feiern von Nonsensthemen aufseiten des Publikums. Aber Sie haben recht: Politisch tätig sein heißt heute, unter Dauerbeobachtung zu stehen, getrieben, stets zu Ad-hoc-Kommentaren genötigt, immer auf Sendung. Hans Magnus Enzensberger hat vor etlichen Jahren einmal Erbarmen mit Politikern gefordert. Er meinte das ironisch. Sein Essay war gepflegte Politikverachtung im Gewand der Satire. Ich würde ganz unironisch sagen: Die Skandalisierung ist im Falle relevanter Grenzverletzungen unbedingt geboten, aber Erbarmen in Zeiten fortwährender Beobachtung und Bedrohung ist jedoch angebracht.
Klassische Medien unterliegen dem Medienrecht. Gegen die fünfte Gewalt, so scheint es, sind wir machtlos. Braucht es neue rechtliche Rahmenbedingungen, und wie könnten diese aussehen?
Pörksen: Nicht notwendigerweise, nein. Es braucht aus meiner Sicht dreierlei. Zum einen die Umsetzung geltenden Rechts auf der Ebene des Einzelnen. Fakt ist: Seit Anfang 2021 ist das sogenannte Doxing, die Veröffentlichung privater Daten ohne Einwilligung der Betroffenen, in Deutschland strafbar. Zum anderen braucht es auf europäischer Ebene die Durchsetzung des geltenden Rechts gegenüber den Plattformbetreibern -der Digital Services Act der EU verpflichtet zur raschen Löschung von Desinformation und Hassrede. Schließlich ist eine Bewusstseinsbildung in der Breite der Gesellschaft nötig -eine gigantische Aufgabe!
Wie soll das funktionieren? Pörksen: So wie in den 1970er-Jahren das Umweltbewusstsein als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten entstanden ist, bräuchte es heute ein Öffentlichkeitsbewusstsein, ein Gespür für den Wert von Öffentlichkeit, für ihre Schutzbedürftigkeit, ihre Gefährdung. Denn Öffentlichkeit ist der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie.
In Österreich, aber auch in Deutschland fällt auf, dass vor allem rechte Bewegungen Social Media viel erfolgreicher nutzen. Das nichtöffentliche virale Verbreiten von Fake News in Chatgruppen - in "Dark Social". Bekommen wir das wieder in den Griff?
Pörksen: Das wird schwer, zumindest in der gegenwärtigen Plattformwelt. Denn es gibt hier eigene Teufelskreise -eine Hochrüstung, ein Sich-Aufschaukeln an der Schnittstelle von digitaler Technologie und rechtsextremer Ideologie. Der Mechanismus: Algorithmen liefern Empörungsanreize. Rechtsextreme bedienen sie. Andere Player steigen auf den Überbietungswettbewerb im Kampf um Aufmerksamkeit ein. Das Kommunikationsklima überhitzt sich weiter usw.
Wie werden wir in zehn Jahren Social Media nutzen?
Pörksen: Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass absolut gar nichts ohne Alternative ist. Ich war die letzten Jahre viel im Silicon Valley unterwegs, habe hier die ersten Online-Gemeinschaften und die frühen sozialen Netzwerke erforscht. Sie waren klein, verzichteten auf Werbung und Anonymität; man war liberal, moderierte die Debatten aber intensiv -mit Erfolg. Finanziert hat man die Arbeit durch Abo-Gebühren. Solche Modelle ließen sich wieder entdecken.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft? Wie könnte eine moderne und aufgeklärte redaktionelle Gesellschaft aussehen?
Pörksen: Darf ich für einen Moment groß träumen? Es wird einen dialogischen Journalismus geben, der einen Beitrag zur Medienmündigkeit in der Breite der Gesellschaft leistet, der über die Spielregeln der eigenen Branche aufklärt. Der harte Kritik übt, aber auch sagt, was funktioniert - und Lösungen mit Wucht einklagt, vielleicht sogar auf globaler Ebene.
Was ist mit Plattformen, den Suchmaschinen?
Pörksen: Google und Amazon sind zerschlagen. Meta ist ökonomisch gescheitert. Mark Zuckerberg surft den Tag über auf Hawaii, er hat sich hierher nach den letztlich erfolglosen Anklagen -Monopolbildung, Datenmissbrauch, mörderische Attacken auf die Rohingya via Facebook -zurückgezogen. Soziale Netzwerke sind wie in der Frühphase der Computerhippies wieder Vertrauensgemeinschaften. Der drohende Ruin des öffentlichen Diskurses durch die Werbefinanzierung von Plattformen gilt weltweit als gefährlicher Irrweg, als eine seltsame Dummheit aus der Zeit der digitalen Pubertät.
Alles gut, also?
Pörksen: Natürlich herrscht bei all dem keine Debattenharmonie, diese wäre auch gar nicht erstrebenswert. Natürlich wird gestritten, geholzt, aber im Letzten voller Freude debattiert. Und alle, die posten und publizieren, wissen, dass drei Fragen wichtig sind: Ist das Gesagte wichtig? Stimmt es? Macht es Sinn?
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: