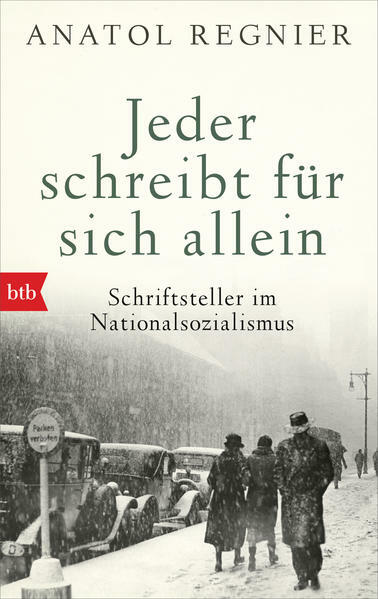Das Böse im Rorschachtest
Michael Omasta in FALTER 47/2023 vom 22.11.2023 (S. 30)
Die tragischste Figur dieses Films ist Douglas M. Kelley. Der US-Psychologe untersuchte 1945 die Hauptkriegsverbrecher, denen in Nürnberg der Prozess gemacht wurde. Mithilfe von Rorschachtests hoffte er, "das Böse an sich" nachweisen zu können. Doch eine Auswertung dieser Versuchsreihe wurde nie veröffentlicht, sie hatte zu keinem einfach greifbaren Ergebnis geführt. Ein paar Jahre später setzte Kelley seinem Leben mit einer Zyankalikapsel, die er als Souvenir aus Deutschland behalten hatte, ein Ende.
Mit dieser Episode, fluid gefilmten, rasch verschwimmenden und sich wieder neu zusammensetzenden Rorschach-Bildern, beginnt Dominik Grafs knapp dreistündiger Dokumentaressay "Jeder schreibt für sich allein", der sich einer Reihe deutscher Autorinnen und Autoren während des Nationalsozialismus widmet: bekannten wie Erich Kästner oder Gottfried Benn, aber auch weithin vergessenen wie Ina Seidel oder Jochen Klepper. Der Film, dessen Österreich-Premiere am Wochenende in Anwesenheit des Regisseurs stattfand, steht dieser Tage noch einige Male auf dem Programm des Metro Kinokulturhauses.
"Jeder schreibt für sich allein" ist eine filmische Übersetzung des 2020 erschienenen gleichnamigen Sachbuchs von Anatol Regnier, der familiär auch selbst in diese Geschichte verstrickt ist. Seine Großmutter Tilly, die Witwe des Dramatikers Frank Wedekind, unterhielt eine langjährige Liaison mit Gottfried Benn; seine Mutter Pamela war in den 1920ern mit dem späteren Emigranten Klaus Mann verlobt. Die gesamte Erzählung kreist um die Frage, wie die "Hiergebliebenen" unter der Diktatur gelebt und was sie geschrieben haben.
Hans Fallada beispielsweise, dessen 1946 entstandenem Epochenroman "Jeder stirbt für sich allein" über den Alltag im "Dritten Reich" sich der Titel verdankt, verbrachte die Jahre zwischen 1933 und 1945 zur Gänze auf einem Bauernhof in der tiefsten mecklenburgischen Provinz. Tag für Tag notierte er, "woher der Wind wehte, wie viel Regen fiel, was gesät und geerntet wurde und die Tiere zu fressen bekamen", schreibt Regnier in seinem Buch. "Von der Politik kein Wort. Für mich war dieser Kalender eine Offenbarung. Hier hatte jemand konsequent weggeschaut und sich ganz aufs Private und die Natur zurückzuziehen versucht - ohne Erfolg natürlich. Man konnte im Dritten Reich nicht unpolitisch sein."
Grafs Film mobilisiert ein ganzes Arsenal stilistischer Gestaltungsmittel. Eines davon ist das der Reportage. Er zeichnet die Recherchen des Autors Regnier nach, begleitet ihn in die Keller des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, in das Hotel in Sanary-sur-Mer, wo Klaus Mann auf der Flucht Quartier bezog, oder nach Carwitz ans Grab von Fallada. Dabei erweist sich Regnier, Jahrgang 1945, als charismatischer Erzähler.
"Anatol ist jemand, mit dem man sofort ins Gespräch kommt", bestätigte Graf im Gespräch bei der Premiere. "Er vermeidet keine Konfrontation, hat aber eine unglaublich warmherzige Art und ist mir gleich ans Herz gewachsen. Ich hatte ja nie die Absicht, einen Film über das 'Dritte Reich' zu machen, aber hier bot sich die Chance, auf diese Geschichte draufzuschauen, ohne deshalb in Konkurrenz mit all den vorherigen, politisch-korrekten Auseinandersetzungen treten zu müssen, die einem da im Weg stehen. Anatol hat das in seinem Buch alles umschifft, dem ging es nur um die einzelnen Leben, diese verblüffenden Künstlerbiografien."
Es gibt keine zwei Karrieren, die einander gleichen. Gewissermaßen als "Urknall" darf eine Außerordentliche Sitzung der Preußischen Akademie der Künste in Berlin gelten, die den sofortigen Rücktritt des deklarierten Antifaschisten Heinrich Mann als Vorsitzender der Abteilung Dichtkunst zur Folge hat. Vier Wochen später, am 13. März 1933, wird den Mitgliedern eine von dem großen Lyriker Gottfried Benn aufgesetzte Loyalitätserklärung zur Unterfertigung vorgelegt: "Sind Sie bereit, unter Anerkennung der veränderten geschichtlichen Lage weiter Ihre Person der Preußischen Akademie der Künste zur Verfügung zu stellen? Eine Bejahung dieser Frage schließt die öffentliche Betätigung gegen die Regierung aus und verpflichtet Sie zu einer loyalen Mitarbeit an den satzungsgemäß der Akademie zufallenden Aufgaben der Nation."
Die Mehrzahl der Schriftsteller, selbst Linke wie Leonhard Frank und Georg Kaiser, ja sogar Franz Werfel unterschreiben. Doch nicht einmal für Benn macht sich das Eintreten für den neuen Staat bezahlt: Schon 1934 werden seine Werke verboten, er kehrt in seinen bürgerlichen Beruf zurück und praktiziert wieder als (Militär-)Arzt; gleichwie verfasst er zu dieser Zeit auch einige seiner bleibenden Verse: "Tag, der den Sommer endet".
1938 wird Gottfried Benn endgültig aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und mit Schreibverbot belegt.
"Um die CinemaScope-Weite der Reaktionen zu erzählen, wie Künstler sich unter dem Druck durch das NS-Regime verhalten haben", so Dominik Graf, hätte er aus dem Buch gern eine Serie gemacht, zehn Mal 60 Minuten, aber das sei im deutschen Fernsehen heute nicht mehr möglich.
An Material mangelte es jedenfalls nicht. Neben den erwähnten Reportage-Szenen kommen in "Jeder schreibt für sich allein" historische Archivfilme, Fotos und Gemälde, Spielfilmausschnitte, Handyvideos und eine herrliche Probeaufnahme aus Grafs vorherigem Film, der Kästner-Adaption "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"(mit Tom Schilling und Saskia Rosendahl), zum Einsatz.
Selbst Alltagsbeobachtungen sind in die filmische Textur eingesponnen -etwa die vielen herumliegenden Schuhe auf den Straßen Berlins, die Assoziationen zu einem Schuhberg in einer Gedenkstätte wecken -, und dazu noch eigens geführte Interviews unter anderem mit der Kunstkritikerin Julia Voss, dem Sachbuchautor Florian Illies oder dem Filmproduzenten und Zeitzeugen Günter Rohrbach.
Dass diese Expertinnen und Experten keineswegs immer einer Meinung sind, findet eine Entsprechung in der Gestaltung des Films. Sie setzt kaum einmal auf formatfüllende Bilder, die eine Totalität, ein So-war-es behaupten, sondern auf Bildkacheln mit viel Schwarzraum rundum, der für Mutmaßungen, Halbwahres und Nichtwissen stehen mag. Auch die Interviewten werden meist aus wechselnden Perspektiven gezeigt, mitunter -wie auf einem Split Screen -gleichzeitig en face und im Profil.
Der rigorose Moralismus der 68er-Generation, der heute in Cancel Culture und Wokeness neue Urstände feiert, ist dem Filmemacher Graf so wenig geheuer wie dem Autor Regnier. Beide plädieren eindringlich dafür, Ambivalenzen nicht nur zuzulassen - Graf: "Seid euch doch in eurem Urteil nicht so verdammt sicher!" -, sondern diese auch einfach auszuhalten.
Es geht im Film nicht um Schwarz-Weiß, sondern um die vielen Graustufen von Schuld und Mitverantwortung. Dabei ist die Trennung zwischen Werk und Künstler essenziell, denn man kann die Bücher schwerlich für die Lebensfehler ihrer Autoren verantwortlich machen. "Der Punkt ist", spitzt der Regisseur rhetorisch nochmals zu: "Kann ein Nazi, kann ein Arschloch ein guter Dichter sein? Caravaggio war ein Mörder und hat doch recht gute Bilder gemalt."
Wie unter einem Brennglas gebündelt finden sich all diese Fragen in dem oft strapazierten Begriff der "inneren Emigration". Die vieldeutige Wortschöpfung geht auf Frank Thiess zurück, einen von den Nationalsozialisten nicht immer geschätzten Autor, der sie 1945 gegen die Exilanten (allen voran Thomas Mann) in Stellung brachte, die "aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie" zugeschaut hätten.
Nicht zuletzt Erich Kästner, dessen populäre Romane bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben, machte sich diesen apologetischen Begriff zu eigen. Dass zwischen der privaten und der öffentlichen Person manches nicht übereinstimmt, erhält anekdotische Bestätigung durch Regnier, der sich erinnert, dass er und seine Geschwister immer ganz leise sein mussten, wenn der große Kinderbuchautor - in Wahrheit "ein Kinderhasser" - zu Besuch kam.
Der Blick ins Literaturarchiv allerdings zeigt, dass auch von Kästners angeblichen "zwölf Jahren Berufsverbot" keine Rede sein kann; unter Pseudonym schrieb der Autor -mit Billigung von Minister Goebbels persönlich - 1942 etwa am Drehbuch zu dem Prestigefilm "Münchhausen" mit.
Überhaupt ist Kästners Aussagen nicht so ohne weiteres zu trauen. Nach dem Krieg versicherte er, Augenzeuge der Bücherverbrennung am Berliner Opernplatz gewesen zu sein. Eine berühmte Geschichte, die der Film natürlich nicht auslässt, doch wechselt der -unter anderem von Regisseur Graf selbst gesprochene -Off-Kommentar an dieser Stelle unauffällig in den Konjunktiv. Auch den großen Roman über Alltag und Wahnsinn des Nationalsozialismus, den zu schreiben Kästner in Deutschland geblieben war, brachte er nie zu Papier.
Dennoch fände er den Begriff der inneren Emigration auch mit Blick auf Erich Kästner nicht unpassend, sagt Dominik Graf. "Das wäre doch eine legitime Reaktion. Das könnte man sich doch auch für sich selbst vorstellen, denn man fragt sich bei diesen Geschichten ja immer: Wie würde ich reagieren? Zu sagen:'Nein, ich gehe jetzt nicht in den Widerstand, auch nicht ins Ausland, ich muss für meine Mutter sorgen, ich igle mich ein und werde versuchen, diesen Wahnsinn von außen zu beschreiben' - auch wenn das auf tragische Weise nicht g klappt hat, so kann ich diese Reaktion noch am ehesten nachvollziehen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass man Kästner einfach gern verzeiht."
Je länger der Film dauert, umso düsterer wird er. Zuletzt kommt mit Will Vesper ein Autor ins Spiel, der sich ganz in den Dienst der nationalsozialistischen Propaganda stellte. Über seinen Sohn, Bernward Vesper, der im Romanessay "Die Reise" das furchtbare Verhältnis zum Vater und seine eigene Radikalisierung reflektierte, schlägt der Film wie das Buch eine Volte zu dessen Verlobter Gudrun Ensslin und der Terrororganisation RAF.
Gegen den Hochmut dieser Nachgeborenen, die ihren Eltern zeigen wollten, was sie in der NS-Zeit hätten tun sollen, setzt "Jeder schreibt für sich allein" vorurteilslose Empathie und Interesse an den Widersprüchen des Menschen: Wie sicher kann man sich seiner selbst sein?