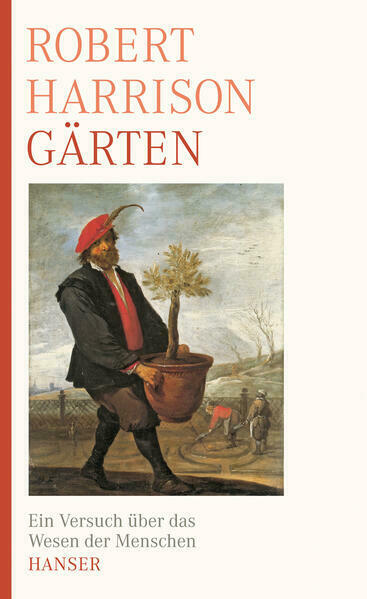Gärten sind Gegenwelten, auch zur Natur
Julia Kospach in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 45)
Robert Harrison erzählt über die Gartenkunst als Sinnbild kultureller Aktivitäten
Es gibt sie, die erhebenden Bücher, die einen verlässlich heiter stimmen. Die einem das Gefühl geben, eine Spur besser und kultivierter geworden zu sein. Die im selben Maß unterhalten, in dem sie den Wissenshorizont erweitern und das Denken anregen. Der neue Band aus der Feder des amerikanischen Autors, der an der kalifornischen Stanford University französische und italienische Literatur unterrichtet, ist alles, nur kein dem Vorurteilsklischee entsprechender akademischer Exkurs in die Kulturgeschichte von Gärten.
Stattdessen beschäftigen Harrison Gärten "als Sinnbilder verschiedener kultureller Aktivitäten, die nicht buchstäblich (
) mit dem Anlegen von Gärten zusammenhängen".
Der Begriff des Kultivierens im doppelten Wortsinn, als Charakterschulung und als Bearbeitung eines Gartens, ist für ihn zentral. Deswegen beginnt er mit dem berühmten Schluss von Voltaires "Candide": "Il faut cultiver notre jardin." "Wir müssen unseren Garten bestellen" – und das heißt, einen Garten vor dem Hintergrund der Kriege und Naturkatastrophen, die Voltaire schildert.
Das ist wichtig, denn im paradiesischen Eden machte das Bestellen eines Gartens keinen Sinn. Das Kultivieren, so Harrison, kommt nach dem Sündenfall, Gärten gewähren Einblick in ein verlorenes Paradies. Nur angesichts von Sterblichkeit und Historie kann "notre jardin" entstehen, der ein Kind der menschlichen Sorge und Sorgfalt ist. "Ohne Gärten wäre die Geschichte eine Wüste. Ein von der Geschichte losgelöster Garten wäre überflüssig." Denn die Geschichte lässt sich als ein endloser Konflikt zwischen den Kräften des Zerstörens und den Kräften des Kultivierens beschreiben. So betrachtet wird "das Leben zur Teilmenge des Gartenbaus", ein Zitat aus dem vergnügt-verschrobenen Gartentagebuch "Das Jahr des Gärtners" des tschechischen Autors und Gärtners Karel Capek.
Das ist eine große Ansage, die Harrison auf den folgenden 300 Seiten leichtfüßig und voller gelehrter Originalität einlöst. Zur Ausführung seiner Gedanken wandert er durch eine Vielzahl mythischer, historischer und literarischer Gärten. Dabei sind seine Übergänge von einem Thema zum nächsten von beispielhafter Eleganz. Das biblische Eden und die zauberhafte Garteninsel der Kalypso aus Homers "Odyssee" stehen für Gärten, die verlassen werden müssen, damit der Mensch heraus aus der "moralischen Bewusstlosigkeit" des Paradieses und zur "Vita activa" finden kann. Am Beispiel der in einem Hain gelegenen Akademie Platons und von Epikurs Gartenschule erzählt Harrison von Gärten als Orten der akademischen Unterweisung, wo der Lehrer im Idealfall "den Samen in die Seele eines Schülers" pflanzt. Diese Verquickung von Garten und Pädagogik findet er auch im parkähnlichen Campus seiner Heimatuniversität Stanford wieder.
Die Tatsache, dass wir Dinge wie Gärten schaffen, sei seltsam, schreibt Harrison: "Denn es bedeutet, dass es Aspekte unserer Menschlichkeit gibt, für die die Natur natürlicherweise keinen Platz hat, für die wir inmitten der Natur Platz schaffen müssen."
Gärten sind Gegenwelten – auch zur Natur selbst. Harrison analysiert die ordnende Rückzugsfunktion der (pflanzenlosen) Obdachlosengärten in den Slums von New York, findet in der "exquisiten Architektur" von Boccaccios "Decamerone" die Struktur der italienischen Renaissancegärten wieder und erzählt beinahe wider Willen auch von Versailles: für Harrison ein Garten, der keine Tugenden kultiviert (wie jener des Epikur), sondern Laster, wenn auch in ihrer kultiviertesten Form: Denn Versailles, "dieses stolze Vergnügen, der Natur Gewalt anzutun", entstand aus dem Neid Ludwigs des XIV. auf die Gartenanlage von Vaux-le-Vicomte, mit deren hochmütiger Pracht sein Innenminister Nicolas Fouquet den Zorn seines Herrschers herausgefordert hatte.
Harrison denkt auch darüber nach, ob unser Zeitalter überhaupt noch den Willen und das Konzentrationsvermögen besitzt, um sich so "gedankenreiche Gärten" wie etwa die großen britischen Anlagen Stowe oder Stourhead, die als "Orte der Selbstfindung" angelegt wurden, zu erschließen. Viele Gärten, so Harrison, zeigen sich den meisten von uns nicht mehr, weil wir aus Zeitmangel blind sind für ihr Wesen.