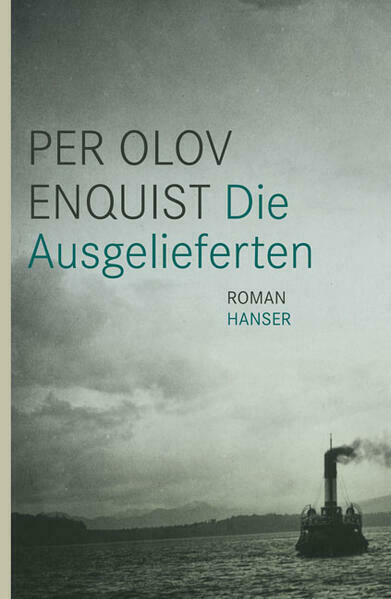Das Land stinkt nach Blut
Erich Klein in FALTER 17/2011 vom 27.04.2011 (S. 34)
In seinem Roman "Die Ausgelieferten" befasst sich Per Olov Enquist mit einer historischen europäischen Tragödie von aktueller Relevanz
Eure Majestät, ich bin ein Mädchen von neun Jahren, das von den Balten gelesen hat. Ich bitte Euch, lieber König, lasst sie hier bleiben, damit sie nicht sterben müssen." Adressiert war dieser Bittbrief des schwedischen Kindes vom 5. November 1945 folgendermaßen: "An den König, Stockholm, Schloss".
Bei den angesprochenen Balten handelte es sich um ehemalige Wehrmachts- und SS-Soldaten, die nach erfolgreicher Flucht aus dem sogenannten Kurlandkessel vor der heranrückenden Roten Armee am 8. Mai 1945 im schwedischen Gotland gelandet waren – mitten in der Ostsee und auf sicherem Boden. Nach achtmonatiger Internierung in diversen Lagern wurden sie nach vorauseilend untertäniger Zustimmung der schwedischen Regierung auf sowjetische Anfrage hin an die Russen ausgeliefert.
Der Gegenstand der "Ausgelieferten", des zweiten Romans des damals 30-jährigen Per Olov Enquist, mutet marginal an. Die Alliierten hatten knapp vor Kriegsende die Voraussetzungen für die Nachkriegsordnung und den Wiederaufbau geschaffen: Gefangene deutsche Soldaten sollten an jene Siegermächte übergeben werden, gegen die sie zuletzt gekämpft hatten.
An die 200.000 Ausländer befanden sich im Sommer 1945 in Schweden und bereiteten der Regierung gehöriges Kopfzerbrechen. Die 167 vorwiegend aus Lettland stammenden Soldaten in deutscher Uniform fielen da kaum ins Gewicht. Allerdings wäre das im Krieg neutrale Schweden zu keiner "Repatriierung" verpflichtet gewesen – der Nachbar Norwegen etwa weigerte sich, 20.000 Deutsche an die Sowjets zu überstellen. Und die ehemaligen baltischen Legionäre befürchteten nicht ganz zu Unrecht den sicheren Tod
Enquist holt in seinem fast 500 Seiten starken Reportageroman weit aus – anhand historischer Exkurse, in Gesprächen mit unmittelbar Beteiligten und in luziden Reflexionsschleifen über seine eigene Beobachterposition führt er rasant ins Zentrum der Tragödie, die durch die restriktive schwedische Einwanderungspolitik (schon vor dem Krieg), die traditionelle Germanophilie und die riesige Angst vor dem großen Nachbarn Sowjetunion herbeigeführt wird.
Während sich die Balten in klapprigen Fischkuttern und Schlauchbooten nach Schweden durchkämpfen, wird die komplizierte politische Geschichte ihrer Länder zwischen deutschen Begehrlichkeiten, der Lage am Rande des Zarenreiches und im Vorhof der Sowjetmacht referiert. Manche der Soldaten trugen binnen weniger Jahre die Uniformen von vier verschiedenen Armeen. Alle "Befreiungen" zwischen 1940 und 1944 waren von Massakern und Massendeportationen begleitet, und die Letten hatten sich darüber hinaus eifrig am Holocaust beteiligt.
Die schwedische Öffentlichkeit erfährt von all dem nur nach und nach: Anfangs wurde den Soldaten sogar nahegelegt, sich einfach als Zivilisten auszugeben, was die Offiziere in der Hoffnung, ihnen würde entsprechend der Haager Konvention auch in Kriegsgefangenschaft der Sold ausbezahlt, ablehnten. Noch wird die Idylle nach Kriegsende – mit Liederabenden und Fußballspielen zwischen Internierten und Wachmannschaften – lediglich durch kleinere Reibereien zwischen Deutschen und Balten, Polen und Österreichern gestört. Auf das Vorhaben der Schweden, sie an die Russen auszuliefern, reagieren sie allerdings höchst entschlossen mit Hungerstreik. Dass die Flüchtlinge mittlerweile aus verschiedenen Lagern in Ränneslätt zusammengefasst wurden, kommentiert der Erzähler sarkastisch: "Die baltischen Legionäre waren jetzt alle versammelt, und das Spiel konnte beginnen."
Der Vorabend des Kalten Krieges reißt eine Kluft in die schwedische Gesellschaft wie kaum ein politisches Ereignis davor und danach, auch wenn die nun allein regierenden Sozialdemokraten meinten, eine pragmatische Formel gefunden zu haben: "Die deutsche Armee, die so viel Böses angerichtet hatte, sollte sich den Folgen der Niederlage nicht einfach entziehen können. In der Sowjetunion gab es viel aufzubauen."
Die Stockholmer Metallarbeitergewerkschaft steht unmissverständlich hinter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Per Albin Hansson und wendet sich "auf das bestimmteste gegen die Kampagne, die unter dem Deckmantel der Humanität von reaktionärer bürgerlicher Seite organisiert" werde – ein Standpunkt, der auch von König Gustav Adolf geteilt wird.
Die Stimmung in der Bevölkerung bringt allerdings ein Göteborger Pastor in seiner Predigt auf den Punkt: "Das ganze Land stinkt nach unschuldigem Blut, unsere Fahne ist auf ewig befleckt. Unsere Reichstagsabgeordneten und unsere Regierung werden von Gott ihre gerechte Strafe erhalten."
Böse Zungen behaupten überhaupt, es sei eigentlich um ein künftiges schwedisch-sowjetisches Wirtschaftsabkommen gegangen und die Balten wären gegen eine dringend benötigte Kohlelieferung aus Polen an Stalin verkauft worden.
Zahlreiche Selbstmorde und Selbstverstümmelungen unter den Internierten ändern nichts mehr: Am 18.
Januar 1946 legt in Trelleborg der russische Frachter "Beloostrov" an, und die schwedische Polizei führt eine fast mustergültige Abschiebeaktion durch.
Allerdings kommt es noch zu einem "peinlichen Zwischenfall", als es einem jungen Letten, der sich die Venen aufgeschnitten hatte und auf einer Bahre an Bord gebracht werden musste, fast gelingt, sich auf den Kai zu stürzen.
In solchen Momenten handhabt Enquist die kafkaeske Lakonie auf grausamste Weise und höchstem
Niveau: "Der zweite Zwischenfall ereignete sich um 13.34, als der lettische Leutnant Peteris Vabulis sich mit einem Messer den Hals aufschnitt und auf der Stelle verstarb. Im übrigen verlief auch die zweite Phase der Einschiffung ruhig."
Was folgt, ist das bizarre und gespenstisch anmutende Schlusskapitel jenes "existenziell politischen Dramas", das Per Olov Enquist mit der Frage, "Wie misst man die Größe von Tragödien?", beendet.
Um herauszufinden, was mit den "heimgeführten" Balten geschieht, reist er 1967 in die Sowjetunion, um einige der ehemaligen Legionäre aufzusuchen. In einem Gemisch aus Naivität, Unverfrorenheit und Insistenz gelingt ihm das auch – trotz Überwachung und Manipulation.
Alle gewonnenen Erkenntnisse werden dabei mit zahllosen relativierenden Fragen und Konjunktiven versehen – immerhin ist zu erfahren, dass 46 der ehemaligen Legionäre im
August 1946 freigelassen, 18 jahrelange Strafen im Gulag abbüßten und
etliche Todesurteile vollstreckt wurden.
Fast noch wichtiger als diese Einsichten aber sind die Fragen, die sich der Autor selbst (und dem Leser) stellt: "Gibt es politische Morde, die man leichter akzeptieren kann als andere?" Oder: "Kann man Morden abstufen, sodass der sinnlose Mord an einem Juden,
ein Mord, der auf Rassenwahn beruht, als schlimmer erscheint als der ideologische Mord an einem Kulaken?"
Das Resümee, das Enquist dem Buch 2010 hinzugefügt hat, plädiert dafür, dass sich Europa endlich allen Fragen seiner Vergangenheit stellen möge. Und er fügt hinzu: "Die Auslieferung der Balten bleibt weiterhin
virulent."