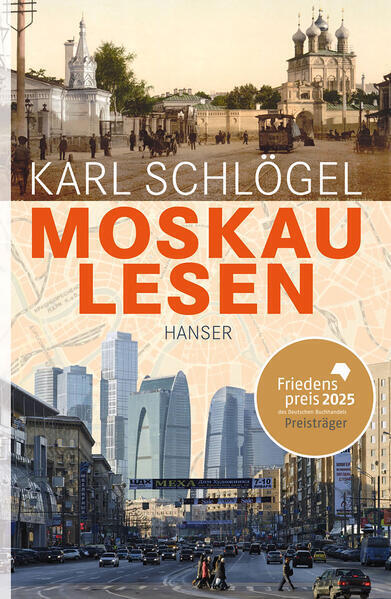Reisen ins Herz des Kalten Krieges
Erich Klein in FALTER 10/2011 vom 11.03.2011 (S. 41)
Moskau: John Steinbeck und Karl Schlögel beschreiben das Russland der Jahre 1947 und 1984
Das Pathos, das der amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger John Steinbeck (1902–1968) an den Anfang seiner Reise nach Russland im Jahre 1947 stellte, war kaum zu überbieten: "Was gibt es in der Welt für einen ehrlichen und liberal denkenden Mann noch zu tun?"
Zur Erinnerung: Die UdSSR, soeben noch Verbündeter im Kampf gegen Hitler-Deutschland, war gerade dabei, Osteuropa zu sowjetisieren, die Welt raste auf den Kalten Krieg zu. Man lese ständig über Stalin, die Pläne des russischen Generalstabs, über Experimente mit Atomwaffen – ihn, Steinbeck, interessiere aber, was in Russland wirklich Sache sei, was die Menschen dort essen, denken, wie sie Feste feiern, all das, was "wie bei uns das ganz normale Leben ausmacht".
Die besorgten Ratschläge seiner Freunde, er würde von den "commies" verschleppt oder gleich gefoltert, schlägt Steinbeck in den Wind, allerdings fürchtet er schon beim Flug Stockholm–Leningrad ob der klapprigen sowjetischen Transportmaschine um sein Leben. Breiten Raum in der Beschreibung des zweimonatigen Aufenthalts mit Abstechern in die Ukraine und nach Georgien nehmen die Schwierigkeiten der Unterbringung ein, bürokratische Schikanen und absurde Verbote – mitunter amüsant, ist das Ganze meist doch eher maßvoll kafkaesk.
Der Krieg ist noch allgegenwärtig
Russlandreisende haben Schlimmeres erlebt, allerdings auch Dümmeres berichtet! Steinbecks Stärke liegt nicht in der politischen Analyse – er muss sogleich einem Kulturbeamten erklären, "Politik außen vor zu lassen" –, sondern in der Beobachtung kleiner Details, die nicht "vorgesehen" sind: Im Anflug auf Leningrad sind es die Spuren der 900-tägigen Belagerung, ausgebrannte Kolchosen und aufgewühlte Schützengräben, in Moskau gibt es noch immer amerikanische Konserven und Dosen mit Krabbenfleisch samt japanischer Originalbeschriftung.
In der Hauptstadt, die sich auf ihre 800-Jahr-Feier und das 30. Jubiläum der Oktoberrevolution vorbereitet, herrscht noch Selbstversorgung: "Die im Krieg angelegten Nutzgärten existieren immer noch und werden weiterhin gepflegt." Die Stalinpropaganda ist überall präsent, zu Gesicht bekommen die beiden Reporter den Generalissimus aber nicht. Bei einer Flugschau ist seine Präsenz immerhin spürbar: "Die Reaktion auf seine Ankunft war kein Jubelschrei, sondern ein Summen wie von Millionen."
Es folgen die obligatorischen Besuche von Leninmuseum, Mausoleum und Metro, natürlich immer in Begleitung der offiziellen Dolmetscherin "Sweet Lana", die klassenbewusst mit ihrer Verachtung für die dekadente Kunst des Westens nicht hinter dem Berg hält.
In Moskau stellt Steinbeck bedrängenden Ernst fest, in der Ukraine, dem "Brotkorb Europas", wirkt alles fröhlicher: die Schwimmer im Dnjepr und die Zirkusbesucher, selbst die ehemaligen Piloten und Panzerfahrer, die jetzt als Taxilenker arbeiten; unendlich geduldig sind die Menschen beim Schlangestehen, auch wenn es einmal zu einem "prächtigen Damenkampf" kommt. Auch hier ist der Krieg noch allgegenwärtig, Kiew "ein halber Trümmerhaufen". "Wir sahen in der Sowjetunion nur sehr wenige Prothesen, obwohl hier so viele benötigt werden."
Fotografieren durfte man das Elend sowieso nicht, ebenso wenig wie die Aufbauarbeiten und jene, die sie leisteten. Umso genauer Steinbecks Beschreibungen: "Und nun marschieren die Gefangenen in ihren deutschen Wehrmachtsuniformen im Gänsemarsch durch die Stadt, um die Zerstörung zu beseitigen, die sie angerichtet haben. Und das ukrainische Volk würdigt sie keines Blickes. Sie wenden sich ab, wenn die Kolonnen durch die Straßen marschieren. Sie schauen durch diese Gefangenen hindurch und über sie hinweg und sehen sie nicht. Und dies ist vielleicht die schlimmste Strafe, die über sie verhängt werden kann."
Von Erdlöchern auf den Mtazminda
Der Besuch einer Kolchose endet in Ratlosigkeit: Auf die Frage, wie eigentlich amerikanische Farmer leben, wissen Steinbeck und der Fotograf Robert Capa, der ihn begleitete, keine Antwort, ebenso wenig auf jene: "Werden die Amerikaner bei uns einfallen mit ihren Atombomben?" (Stalin sollte seine erste Atombombe erst zwei Jahre später zünden.) Dieselbe Frage auch in Stalingrad, dessen Bewohner in Ruinen und Erdlöchern hausen. Einem Jungen, der täglich den Park aufsucht, in dem sein Vater begraben ist, setzt Steinbeck ein rührendes Denkmal.
Höhepunkt der Reise ist ein Georgienbesuch – dem Land eilt ein schmeichelhafter Ruf voraus: Wenn ein guter und gerechter Mensch stirbt, kommt er nicht in den Himmel, sondern nach Georgien. Schon beim Zwischenstopp in Suchumi steht alles im Zeichen der Lebensfreude.
Die Flugzeugbesatzung nimmt kurzerhand ein Erfrischungsbad im Schwarzen Meer und lässt die Passagiere warten. Das Essen, Trinken, die Trinksprüche – es gibt alles im Übermaß, maßlos ist die Stalinstatue auf dem Mtazminda, dem Berg über Tiflis, und die Verehrung Stalins, des (damals) größten aller Georgier, in seinem Geburtsort Gori.
Ein zufälliges Fußballspiel, die nächtliche Zugfahrt an die georgische Schwarzmeerküste mit ihren Teeplantagen und Sanatorien sind der beste Teil des Berichts. Als Steinbeck dem unentwegt "In the Mood" spielenden Tiflis Jazz Orchestra endlich den Sinn von Improvisation, Swing und Benny Goodman erklären kann, ist er endlich in seinem Element.
"Uns ist klar, dass dieser Bericht weder für die orthodoxe Linke noch die verkommene Rechte besonders befriedigend ist", erklärt er resümierend am Ende seines um Ausgewogenheit bemühten Berichts einer Reise ins Herz des Kalten Krieges. Der einzige Wermutstropfen: John Steinbecks grandiose "Russian Journey", die von seinen Zeitgenossen schon als "conducted tour" kritisiert wurde, hätte ein ausführliches Nachwort verdient.
Denn den beiden Yankees und Greenhorns wurde von ihren sowjetischen Gastgebern nicht nur vieles aktiv vorenthalten, sie berichten auch über vieles nicht, was sich direkt vor ihren Augen abgespielt haben muss: Hunger, Chauvinismus, Kriegstreiberei.
Geh doch rüber!
Von Moskau aus konnten in einem achtstündigen Inlandsflug die meisten Klimazonen dieser Welt erreicht werden, und alle Reisen im Land führten über die Hauptstadt. Dieser Umstand verwunderte John Steinbeck – der deutsche Historiker Karl Schlögel macht ihn in "Moskau lesen" zum Ausgangspunkt von zwei Dutzend kulturgeschichtlichen Spaziergängen durch die seinerzeitige Hauptstadt des Kommunismus. Moskau ist Teil und Ganzes, Welt und Ziel der Menschheit.
Dass das Unternehmen Sowjetunion 1984, als das Buch entstand, in pompöser Monotonie dem Ende zuging, war spürbar, dass es aber dann doch so rasch gehen sollte, war nicht abzusehen. Der Ex-68er Schlögel hat gerade die Fraktionskämpfe der bundesrepublikanischen Linken hinter sich gelassen und beherzigt, was damals altdeutsch hieß: "Geh doch hinüber!"
"Wir mussten klarkommen mit der Frage, was es damit auf sich hatte, dass Abermillionen im Namen einer Idee zermalmt worden waren." Also legt Schlögel akribisch die Schichten der Utopie – und woraus sie entstand – frei. Die Rolle des aufstrebenden Moskauer Bürgertums um 1900 wird neu definiert, die Revolutionäre werden in ihren Museen aufgesucht, der Homo sovieticus in seinen Ritualen und Mythen rekapituliert.
Die architektonische Avantgarde – der Schlögels besondere Aufmerksamkeit gilt – hatte ihre Vorgänger, und sie hatte ihre Vollender in der stalinistischen Baugeschichte, die nach Schlögel nicht als bloße "Zuckerbäckerarchitektur" abgetan werden kann.
Essayistisch wird das Moskau der Fabriken und Arbeiterklubs, der Hochhäuser (statt Wolkenkratzer), der ungebauten Phantasmagorien inklusive der unterirdischen Welt der Metro zu jenem monumentalen Panorama zusammengefügt, das die Stadt entsprechend dem Generalplan des Jahres 1935 hätte sein sollen.
Moskau liegt wieder in Europa
Dass diese Version von "Wsja Moskwa", "Ganz Moskau", wie ein seinerzeitiges Adressverzeichnis hieß, nicht antiquarisch verstaubt wirkt, ist den angefügten "Notizen 1988–2010" gedankt – auch wenn Karl Schlögel einige Peinlichkeiten unterlaufen (z.B. "der männlich elegante General Rutzkoj") –, dass sich in West und Ost die Dissidenten durchsetzten – ein frommer Wunsch.
Aber auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion gilt: "Moskau hat 1991 keinen Putsch vereitelt, sondern einen weltgeschichtlichen Ausnahmezustand beendet. Die Bürger Moskaus haben keinen Kommunismus niedergeworfen, sondern die Herrschaft der Vergangenheit über das Leben abgeworfen." Eine Pflichtlektüre für alle, die noch nicht wissen, dass Moskau wieder in Europa liegt.