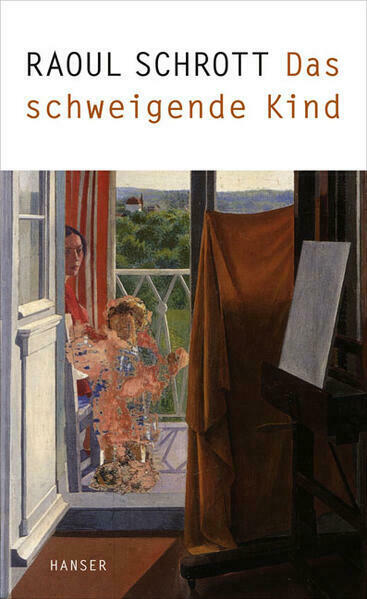Schweigende Kinder, abwesende Väter
Leopold Federmair in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 8)
Ein Kind verstummt" lautet die fünfte poetologische Grundfigur nach Paulus Hochgatterer. Insgesamt kommt er in seinen Zürcher Poetikvorlesungen auf acht solcher Figuren, die er in betont einfachen Sätzen formuliert. Existieren, sprechen, erzählen, schreien, verstummen, zuhören, spielen, sterben, das sind in der Tat grundlegende menschliche Vermögen und Gebrechen; Zeichen, dass etwas stimmt oder nicht stimmt.
Hochgatterer hat sie in Zürich, während er allerhand Geschichten aus seinem Leben und seiner Praxis erzählte, wie nebenbei aufgelistet und, seiner alltäglichen beruflichen Tätigkeit entsprechend, auf "das Kind" und seine Entwicklung bezogen. Erzählen, bekräftigt er in seinen Ausführungen, ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, die dem Individuum Identität und der Gruppe Zusammenhalt sichert. Wo nicht erzählt, nicht mehr zugehört, nicht mehr gespielt (und nachgeahmt, ausprobiert) wird, gerät die Möglichkeit von Identität in Gefahr, und in manchen Fällen die Existenz eines Menschen, eines Kindes. Erzählen ist kein Luxus, und Schreiben auch nicht.
"Ein schweigendes Kind", so lautet der Titel der neuen Erzählung Raoul Schrotts, als hätte der Autor damit die fünfte poetologische Grundfigur seines Kollegen veranschaulichen wollen.
Ein Kind ist verstummt, und ein Mann spricht, notiert, schreibt sich sein Leben von der Seele. Der Mann ist der Vater dieses Kindes, offenbar längst gealtert, am Ende des Buchs erfahren wir von seinem Tod (die Zeitvolumen sind in dieser Erzählung ziemlich nachlässig gestaltet). Das Kind, so kann man vermuten, ist längst erwachsen, wahrscheinlich hat es irgendwann zur Sprache gefunden und Wege, um mit seinem Leben zurechtzukommen, quasi als Vollwaise, denn seine Mutter ist gestorben, als es klein war, und der Vater, ein bildender Künstler, hat seine Identität verloren, falls er je eine besaß.
Dem Vater, der von der Mutter des Kindes zur damaligen Zeit schon getrennt lebte, wurde früh das Sorgerecht abgesprochen. Ein Großteil der Erzählung spielt in der Zeit der elterlichen Kämpfe um das Kind. Es ist da eine Nähe und Betroffenheit beim Erzähler, dem seines Kindes verlustig gegangenen Vater, zu spüren, wobei sich am Ende der Lektüre allerdings herausstellt, dass er über eine Distanz von vielen Jahren hinweg erzählt, nach einem Leben, über das wir nicht viel erfahren, außer dass es gescheitert ist.
Im Nachwort, das die Form eines Briefes hat, den der Psychiater – und Freund, wie er behauptet – des Vaters an dessen Tochter schickt, wird die ganze Erzählung relativiert, den Aufzeichnungen sei "nicht überall zu trauen". Der Psychiater weist, ganz zu Recht, wie es scheint, darauf hin, dass die Erzählung Dinge enthält, "die ein Vater seiner Tochter nie beichten dürfte". Sadomasochistische Sexualpraktiken zwischen den Eltern zum Beispiel – welches Kind will so etwas lesen? Wozu? Um zu leiden? Um selbst in den Sadomasostrudel hineingezogen zu werden? Dabei glaubt der schreibende Vater, auf Versöhnung und Erinnerung zum Zweck der Ich-Stabilisierung aus zu sein. Noch ein Akt der Unverantwortlichkeit, das Schreiben! Hören wir besser auf den Psychiater: Dieser Erzählung ist nicht zu trauen. Der Mann ist eben doch seelisch gestört, sein Schreiben nicht mehr und nicht weniger als ein umständlicher Ausdruck dieser Störung. Aber warum leitet der Psychiater dann den Text an die Tochter weiter?
Hören wir nicht auf den Psychiater! "Das schweigende Kind" ist eine fiktionale Erzählung von Raoul Schrott, und wie jede Fiktion hat sie etwas von Halluzination, das ist ihr gutes Recht, so funktioniert das erfindende Schreiben. Unter dieser Voraussetzung kann und soll man die Erzählung ernst nehmen. Nimmt man sie aber ernst, kann man einiges davon schwerlich ernst nehmen, vor allem die Schlusspassagen, in denen Schrott einerseits die Verwicklungen aufzulösen, andererseits ein gewisses Maß an Mysteriösem im Raum stehen zu lassen trachtet.
Als Leser ist einem dieser gestörte Vater höchst unsympathisch, viel unsympathischer, scheint es, als dem Autor. Der Mann plädiert im Grunde genommen 200 Seiten lang auf Unschuld, Halbschuld und mildernde Umstände. Schuld an seinem Schlamassel, am Verstummen des Kindes und an ihrem eigenen Tod sei letzten Endes die Frau; die eigene Schuld bestehe nur in seiner Schwäche, die ihn zum Gewalttäter hat werden lassen.
Wenn der Rezensent die Geschichte richtig verstanden hat, dann ist das Kleinkind über einer solchen Gewaltszene, die als Mordversuch an der Lebensgefährtin und Mutter beschrieben wird, verstummt. Später gibt der Vater einem kroatischen Killer den Auftrag, die Mutter zu beseitigen. So jemand, fragt man sich – so jemand setzt sich mit seiner Schuld auseinander, indem er sich als Verführten, Ausgenutzten, Missbrauchten schildert? In seinen Klagen über den Verlust des Kindes schwingt mit, dass für ihn die Beziehung zum Kind der Lebensmittelpunkt sein sollte und auf negative Weise immer noch ist, und es schwingt mit, dass er selbst recht gut weiß, wie sich das Zusammenleben mit dem Kind positiv gestalten ließe.
Nun sind aber gerade diese Passagen über das erlebte Vater-Kind-Glück vage, gerafft, wie alibimäßig eingestreut. Am tollsten findet es der Vater, wenn er seine kleine Tochter in die Luft wirft und wieder auffängt. Auch Paulus Hochgatterer empfiehlt dieses Spiel, das doch wohl nur ein kleinen Teil der Kindererziehung ausmacht, den man gern Onkeln überlässt, wenn sie zu Besuch kommen.
Die durchwegs unerquicklichen Episoden
dieser Geschichte sind in Schrott'scher Sprache zelebriert: gewählt, edel, im Detail auch ein wenig schlampig, viel eingestreutes Bildungsgut, Nordpol und Himmelskörper, die Vorlieben des Autors. Der Mann im Buch ist aber ein Verzweifelter, Gescheiterter, Eingesperrter (oder, wenn man will, ein sich selbst bemitleidendes Arschloch), und seine Sätze feiern sich in einem fort selbst. "Ich habe ihn als sehr sensiblen Menschen kennengelernt", sagt sein Psychiater abschließend. Ob das der Tochter diese für sie zweifellos unverdauliche Lektüre erleichtert? Kleiner Ratschlag: Man muss nicht alles lesen, was einem ins Haus kommt.
Weshalb verstummen Kinder? Paulus Hochgatterer weiß es. Sie erleiden eine Gewalt, gegen die sie sich mit Sprache nicht zur Wehr setzen können: "Ein Kind verstummt, weil da eine wesentliche Inkongruenz zwischen seiner eigenen Welterzählung und jener der wichtigsten Bezugspersonen besteht." Im Lärm der Elternkämpfe kann sich das Kind einfach kein Gehör verschaffen.
Hochgatterer hat selbst einmal eine Erzählung geschrieben, in der ein Vater abhanden gekommen ist: "Wildwasser". Ein Junge macht sich da mit dem Mountainbike auf die Suche nach dem Verschollenen. Warum eigentlich, wird nicht recht klar, und er findet den Vater auch nicht, scheint am Ende aber zufrieden, wenigstens an den Ort des Verschwindens gelangt zu sein.
Gewiss, es gibt Fälle, in denen Väter zu Unrecht von ihren Kindern ferngehalten werden. Das eigentliche gesellschaftliche Problem ist aber nach wie vor, dass sie sich auf die eine oder andere Weise verdrücken, nicht da sind, ihre Aufgaben nicht erfüllen oder diese Art der Liebe, auf die sie einen abstrakten Anspruch erheben, nicht zu leben verstehen. So, wie Schrotts Vater das Erzählpferd aufzäumt, kann dieses Problem gar nicht in den Blick kommen. Daran ändern auch die Relativierungen seines Psychiaters nichts.
Hochgatterer ist im wirklichen Leben ein Psychiater, und wenn er schreibt oder Reden hält, spürt man darin immer auch etwas von der Sorge um seine Patienten, um die Kinder im Allgemeinen, ob krank oder gesund. Er freundet sich nicht mit ihnen an, wirkt nur ein bisschen gönnerhaft, wenn er etwa beteuert, es sei "nur ganz wenig übertrieben, wenn etwa der artistische Sprechgesang des Hip-Hop mit der Lyrik Baudelaires oder Stefan Georges verglichen wird". Wieso Baudelaire? Wieso George? Ein schwadronierender Erzähler hält sich mit derlei Nachfragen nicht auf.
Sorge um die Gesellschaft als solche: Wenn die Jungen so artistisch sind wie weiland Baudelaire, brauchen wir – die Älteren und Alten – uns keine so großen Sorgen zu machen. Mit einigen Phänomenen, die in Hochgatterers Überlegungen immer wieder auftauchen, kommen sie viel besser zurecht, zum Beispiel mit der wachsenden Beschleunigung in allen Lebensbereichen. Auch der Psychiater-Erzähler kommt ganz gut zurecht, er beherrscht die Kunst des Antippens, des raschen Auf-den-Punkt-Bringens, des Herumstöberns in der Fachliteratur, des Namedroppings.
Als Erzähler versucht Hochgatterer, dem modernen oder postindustriellen Rhythmus zu entsprechen. Er gehört nicht zu denen, die der Beschleunigungsbeschleunigung die Langsamkeit einer beschaulicheren Kunst entgegenstellen. Der betrogene Vater Raoul Schrotts erscheint vor dieser Folie als Beschleunigungsverlierer, dem seine humanistische Bildung zur Lösung seines Lebensproblems rein gar nichts nützt.