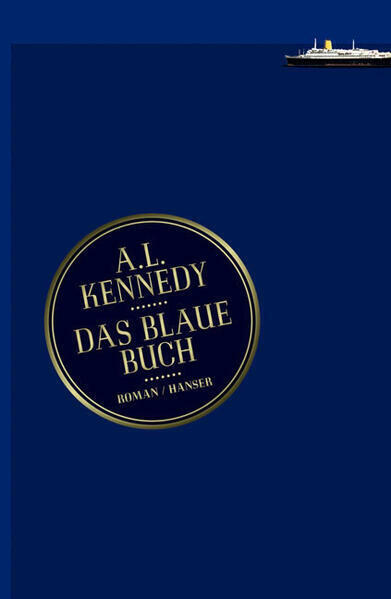Klaus Nüchtern in FALTER 34/2012 vom 22.08.2012 (S. 26)
Ein vergleichender Blick auf die Kontoauszüge von J.K. und A.L. würde Letzterer wohl Tränen der Verzweiflung oder einer höheren Heiterkeit in die Augen treiben. Was die Produktivität anbelangt, kann die 1965 im schottischen Dundee geborene Alison Louise Kennedy mit Joanne K. Rowling, ihrer unendlich berühmteren und reicheren Berufs- und Jahrgangskollegin aus England, aber durchaus mithalten.
Ein halbes Dutzend Romane und ebenso viele Erzählbände hat Kennedy bislang verfasst, drei Sachbücher, einige Arbeiten für Radio, Film und Fernsehen sowie ihre Auftritte als Stand-up-Comedian kommen noch dazu. "Wenn man ein flotter Koch ist, keine Kinder, keine Haustiere und niemand zum Reden hat, was soll man sonst tun?", hat die Autorin mit dem ihr eigenen staubtrockenen Humor ihre profuse Produktivität kommentiert.
Und gezaubert wird auch noch! Bei Kennedy freilich ohne todbringende "Avada Kedavra!"-Flüche, sondern mit Karten, Zylinder, Schaumstoffbällen und Luftballons - also eher kindergeburtstagsmäßig, obgleich das Publikum, das ein sehr mediokrer Magier an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu unterhalten sucht, überwiegend in deutlich fortgeschrittenem Alter ist.
Elizabeth Caroline Barber, genannt "Beth", zählt hier noch zu den Jüngeren und ist als Tochter eines Zauberkünstlers entsetzt von der matten Performance, ermuntert sich aber selbst, "die Mitglieder unserer eigenen Spezies, die versagen und sich unwohl fühlen", nicht zu hassen, "denn sie sind genauso gnadenlos wie ich, und in Wahrheit können sie auch über sich hinauswachsen und lodern, verblüffen und erstaunt sein."
Beth ist eine echte Kennedy-Heldin: klug, empfindsam, immer wieder einsam und - obwohl sie das Gegenteil beteuert: "Ekstase. Die will eigentlich keiner" - wohl auf der Suche nach ebensolcher. Derek, der Mann, mit dem Beth unterwegs ist, wird freilich nicht für diese sorgen: Er reihert schon am ersten Abend seine Kabine voll und wird auch für die folgenden Tage furchtbar seekrank und ergo außer Gefecht sein.
Allerdings ist da noch ein anderer Mann an Bord: Der Leser lernt Arthur Lockwood als äußerst aufdringlichen Zeitgenossen kennen, der riesige Portionen Fleisch in sich hineinschlingt. Spätestens nachdem er sich bei Elizabeth erkundigt hat, ob sie ihren Begleiter heute Nacht zu ficken gedenke, ahnt man, dass er nicht zufällig an Bord ist und dass die beiden eine gemeinsame Geschichte verbindet.
Beth und Arthur sind eines jener Paare, die sich nicht guttun und deren destruktives Potenzial die Protagonistin aus einer alten Erzählung Kennedys mit dem programmatischen Titel "Hat nichts zu tun mit Liebe" triftig wie folgt umschreibt: "Und so wurden wir, was wir sind: jeder ein schlechtes Spiegelbild des anderen. Nichts Besseres, nichts Zarteres, nichts, was mit Liebe zu tun hätte."
Im Übrigen hat Beth - so die sarkastische Pointe, in der die Weltpolitik private Katastrophen präludiert - über das Gleichgewicht des Schreckens dissertiert: ",MAD - Mutually Assured Destruction'. Man könnte es nicht besser erfinden (
) - großartites Gesprächsthema, bringt jede Unterhaltung zum Erliegen, kann sogar ganze Zimmer leeren."
Gesteuert vom Autopiloten der Selbstzerstörung scheinen Beth und Arthur indes für die Liebe anderer Menschen ein gewisses Talent, ja nachgerade eine Gabe zu haben. Über Jahre waren die beiden nämlich auch "beruflich" ein Paar: In Séancen nahmen sie Kontakt mit Verstorbenen auf, wobei sie sich über einen Zahlencode verständigten: Die Eins steht für "Bitte zuhören", zwei für "Mann", drei für "Verlust", vier für "Kind".
Und die Sieben, jene Zahl also, die die meisten Menschen wählen, wenn sie aufgefordert werden, sich eine Ziffer auszusuchen, für die Liebe: "Vergiss jede andere Zahl, man könnte auch eine Sitzung, einen Abend, eine Séance nur damit bestreiten. Dabei braucht sie gar keine Nummer. Sie ist die Konstante. Egal, wie gut die Fragenden lügen, man sieht es ihnen dennoch an - sieben ist es, was sie wollen, ihr Herzenswunsch. Warum sollten sie sonst kommen."
Diese Form des Tischerlrückens, der Arthur nicht abschwören will und kann (wofür er wieder von Beth verachtet wird), macht diesen einerseits zu einem Scharlatan und windigen Betrüger. Andererseits ist es nicht bloß Geldgier oder die schiere Freude an der Manipulation, die ihn weitermachen lässt. Er will seinen Klienten tatsächlich helfen, weiß oder glaubt zumindest zu wissen, dass diese ohne die Illusionen, die er ihnen liefert, zusammenbrechen würden.
Dass Kennedy Sympathien für ihren zunächst ziemlich unsympathischen Protagonisten hegt, steht außer Frage. Ohnedies würde sie sich nie zur Richterin über die eigenen Figuren aufspielen. Bei ihrem jüngsten Roman hat man - nicht unbedingt immer zu dessen Vorteil - des Öfteren den Eindruck, dass diese zu Sprachrohren der Autorin gemacht werden.
"Wir sind Menschen, und Menschen tun so was: Wir leben in Geschichten", lässt sie Beth denken. "Alles verdammte Geschichten: was uns nett macht, was uns zum Reden bringt, was uns hilft, uns selbst zu erkennen, andere zu berühren, selbst berührt zu werden, Liebe zu vertrauen - die verdammten Geschichten." Ist Literatur selbst am Ende nichts anderes als eine Art Séance?
"Das blaue Buch" ist keine einfache Lektüre. Der Strom der Erzählung führt allerlei disparates Material mit sich, bildet Wirbel, tritt über die Ufer. Der auch mit allerlei typografischen Manierismen (Kursivierungen, Fettungen, Versalien
) einhergehende Wechsel zwischen personalem Erzählen und inneren Monologen Beths macht das Fortkommen mitunter zu einer etwas zähen Aufgabe.
Andererseits liegt genau darin das Ethos und der Reiz von Kennedys Literatur, die ihre Figuren nie so kleinerklärt, bis sie banal sind, sondern diesen immer einen ganz eigenen Glamour zugesteht. Der Philosoph Robert Pfaller hat die narzisstische Untugend gegeißelt, die "niemanden anderen einmal grandios sein lassen" könne.
Vor solcher Verbissenheit ist Kennedy vollkommen gefeit. Sie hat ein hartnäckiges Interesse an Paaren und daran, dass diese es auch einmal schaffen, einander "ein gutes Spiegelbild" zu sein. Ein grandioseres Paar als Francis und Bunny wird man zurzeit in der Literatur jedenfalls nicht finden. Wer die nun wieder sind? Lesen Sie "Das blaue Buch"!