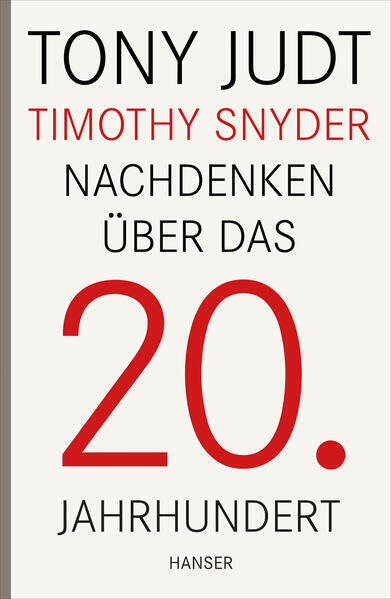Tour de Force durch die politische Matrix
Werner Reisinger in FALTER 33/2013 vom 14.08.2013 (S. 18)
Die Historiker Tony Judt und Timothy Snyder liefern in ihrem gemeinsamen Buch ein gutes Beispiel für positiven Revisionismus
Tony Judt war so etwas wie der Archetyp eines europäischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Als Kind jüdischer Einwanderer in Großbritannien geboren, als junger Mann ein überzeugter Marxist, erlebte er den Mai 1968 in Paris, studierte später in Cambridge Geschichte und ging danach rasch auf Distanz zur theorielastigen Debattenkultur der 68er-Bewegung wie auch der klassischen Linken. Mit dem Mammutwerk "Postwar" schuf er ein Standardwerk. Wie auch Co-Autor und Yale-Historiker Timothy Snyder verstand sich Judt als Fürsprecher der "großen Geschichte".
Dies resultiert wohl nicht zuletzt aus Judts Skepsis gegenüber der historischen Sozialwissenschaft. Deren Konjunktur in den 1970er-Jahren sieht er als disziplinarische Orientierungslosigkeit, als Zeichen von mangelndem "intellektuellem Selbstbewusstsein".
An diesem fehlte es den beiden Autoren ebenso wenig wie an der Ambition zum großen Wurf, und ihr gemeinsames Buch "Nachdenken über das 20. Jahrhundert" ist die logische Konsequenz aus dieser Haltung.
Über Monate hinweg führten die beiden Gespräche; Judt, von der degenerativen Nervenerkrankung amyotrophe Lateralsklerose schwer gezeichnet, war nicht mehr in der Lage, selbst zu schreiben. Interessant ist das Ergebnis schon ob seiner Form: Halb Konversation, halb Biografie, ist das Buch eine Tour de Force durch die politische Matrix des letzten Jahrhunderts. Die einzelnen Kapitel beginnen jeweils mit Judts autobiografischen Erzählungen und führen weiter in einen Schlagabtausch.
Intellektuelles Selbstbewusstsein
"Nachdenken über das 20. Jahrhundert" ist in gewisser Weise auch die Geschichte der Geschichtsschreibung dieses Zeitalters der Ideologien. Die Vergangenheit zu beschreiben bedeutete auch immer eine Obsession mit der Zukunft, die es zu entwerfen galt.
Allen großen politischen Religionen ist gemein, dass sie für etwas kämpfen, dessen sie sich nicht direkt bewusst sind: die Form und die Rolle des Staates. Nach der Zäsur 1989 und dem Beginn der post-utopischen Periode reifte die scheinbare Gewissheit, dass dem starken Staat und wirtschaftspolitischen Interventionen stets die Gefahr einer Entwicklung hin zur Diktatur innewohnen. Nach der Krise von 2009 ist auch der Glaube an die Allmacht der Märkte diskreditiert.
Auch intellektuelles Schaffen war im Rahmen der großen Utopien gefangen. Heute, nach dem Ende der großen Ideologien und der Abwendung großer Teile der Linken vom Dogmatismus vergangener Tage, sind es die Historiker, die dem drohenden Verlust des öffentlichen Diskurses entgegenwirken können.
Appell an die eigene Zunft
Geschichtsschreibung bietet also Orientierung, wo die Politikwissenschaft oft als flache und kommerziell orientierte Expertise über die Bildschirme flimmert. Judt appelliert an das Ethos seiner Zunft: "Wer die Macht hat, die Vergangenheit in seinem Sinne zu interpretieren, auch falsch darzustellen, verfügt über Gegenwart und Zukunft. Demokratien sind also gut beraten, dafür zu sorgen, dass ihre Bürger Bescheid wissen."
Teilweise ist den beiden intellektuellen Schwergewichten beim Lesen schwer zu folgen; stellenweise wirken die Ausführungen über Wesen und Aufgabe des Historikers gar zu belehrend. Hervorstechend bleiben dabei aber immer Judts Nüchternheit, der Fokus auf das Wesentliche, der politische Anspruch.
Linke wären jedenfalls gut beraten, sich an Judts Fähigkeit zur Selbstreflexion, seinem Begriff von Öffentlichkeit, Pluralismus und Demokratie ein Beispiel zu nehmen.
Das ist es letztlich, was dessen Leistungen ausmacht: das Beispiel eines linken Intellektuellen, der stets bemüht war, seinen eigenen moralischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Mit einem Zitat Arthur Köstlers beendete Judt eine gleichermaßen vernichtende wie vielbeachtete Kritik an seinem verstorbenen Kollegen, dem Ausnahmehistoriker Eric Hobsbawm, der sich zeitlebens nie die Niederlage der autoritär-totalitären Ideologie des "real existierenden Sozialismus" eingestehen wollte. "Die Angst, sich in schlechter Gesellschaft wiederzufinden, ist kein Ausdruck von politischer Reinheit. Sie ist Ausdruck eines Mangels an Selbstvertrauen." Ein bisschen Selbstrevisionismus kann eine wahre Wohltat sein.