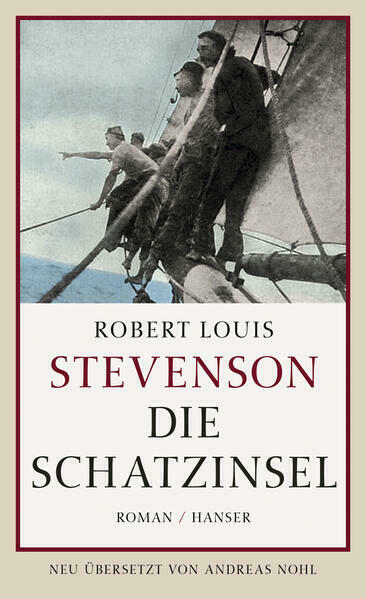Fünfzehn Mann auf des Toten Mannes Kiste
Klaus Nüchtern in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 4)
Eine Neuübersetzung der "Schatzinsel" zeigt auch, wie diese ihrem Autor aus der peinlichen Erfolglosigkeit half
Wenn all die Abenteuerei, / Erzählt auf ganz die alte Art, / Noch Interesse findet bei / Der Jugend unserer Gegenwart: So greift nur zu, dann soll es sein!"
Rückblickend nimmt sich diese "An den zaudernden Käufer" gerichtete Aufforderung, die der Autor seinem Roman vorangestellt hat, vollkommen absurd aus, gilt "Die Schatzinsel", die zunächst in Fortsetzungen in der Zeitschrift Young Folks und 1883 auch als Buch erschien, heute doch als der Abenteuerroman schlechthin.
Und auch die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte heranwachsende Medienkonkurrenz zum Buch hat "Die Schatzinsel" souverän überstanden: An die zwei Dutzend Mal ist sie bislang verfilmt worden. 1934 spielte Wallace Beery Captain Silver, in der 2012 ausgestrahlten opulenten Miniserie gab der Komiker Eddie Izzard diese Rolle, und der ZDF-Vierteiler von 1966, in dem Michael Ande den Jim Hawkins gab (bevor er verflucht wurde als ewiger Assistent die Weltmeere des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu befahren), hat wohl Millionen von Fernsehkindheiten geprägt.
Der Roman ist selbst ein Akt dreister Piraterie, hat sich Stevenson – wie er ganz offenherzig gestand – doch nicht nur Robinsons Papagei ausgeborgt (Daniel Defoes Piratenroman "Die Abenteuer des Kapitän Singleton" ist übrigens 1720, also bereits 160 Jahre vor der "Schatzinsel" erschienen), sondern sich auch weidlich aus der Seemannskiste von Washington Irvings "Tales of a Traveller" (1824) bedient.
Die elsternhaften Ausflüge in die Schmuckkästchen anderer Autoren hatte Stevenson offenbar auch nötig, denn bis zur "Schatzinsel", über deren Entstehung er in einem, in der Neuausgabe abgedruckten Text mit dem Titel "Mein erstes Buch" (!) Rechenschaft ablegt, war er ein von originellen Einfällen nicht eben überwältigter ("Die Länge ist es, die einem das Genick bricht") und dementsprechend erfolgloser Autor.
Sein Stiefsohn Lloyd Osbourne, für den Stevenson "Die Schatzinsel" schließlich schrieb, erinnert sich in einer Nachbemerkung daran, dass ihn die "frohgemute Gelassenheit", mit der sein Stiefvater den eigenen Misserfolg hinnahm, "so manchen heftigen Stich versetzte". Dass es dafür gute Gründe gab, daran lässt Lloyd freilich keinen Zweifel: "Ich wusste, dass seine Bücher sehr schlecht waren, denn als eifriger Leser hatte ich mich durch jedes Einzelne hindurchgequält. In der Tat waren sie so langweilig, dass mich seine Aussage erstaunte, er könne auf ganze siebenhundertfünfzig Leser zählen."
Als Motor der Inspiration sollte schließlich – so erinnert wiederum des Autors Frau, Fanny Van de Grift Stevenson – eine fiktive Landkarte dienen, die in einem Chalet in Davos "auf den blanken Boden gezeichnet" wurde und über der Gatte Robert und ihr Bub "viele Stunden mit einer Art Kriegsspiel zu[brachten], das über meinen Verstand ging".
Das ist nicht ganz unnachvollziehbar, war "Die Schatzinsel" doch als "eine Geschichte für Jungs" konzipiert, für die – wie der Autor selbst in erwähntem Text gesteht – galt: "Frauen waren ausgeschlossen." Diese Charakterisierung stimmt nicht ganz. Immerhin hat John Silver eine "Negerin" zur Frau, mit der er die Taverne führt. Und darüber hinaus gibt es –viel wichtiger – natürlich noch Jim Hawkins' gleich zu Beginn des Romans zur Witwe werdende Mutter. Es ist allerdings schon ziemlich auffällig, dass Hawkins zwar – soweit bekannt – das Schicksal seiner Abenteuergefährten nachliefert, über die doch hoffentlich stattgefundene Wiederbegegnung mit seinem schicksalgebeutelten Mütterlein aber kein Wort verliert. Saubub!
Der Fiktion nach ist "Die Schatzinsel" ein in der Ich-Form verfasster Bericht, den Hawkins im Aufrag seiner erwachsenen Begleiter geschrieben hat; ein aus der Sicht von Doktor Livesey und ebenfalls in der ersten Person erzähltes Kapitel (Nummer 16) wird zu Beginn des vierten Teils eingeschoben, um die Perspektive zu vervollständigen, nachdem der Kampf zwischen den Expeditionsleitern und den meuternden Piraten begonnen hat.
Wie groß die Distanz zwischen Erlebtem und Erzähltem ist, wird nicht geklärt, es spricht aber einiges dafür, dass es Jahre sind. Ein Bub, der bislang in der elterlichen Schenke an der Küste aufgewachsen ist, aber "dem Meer nie wirklich nahe" gewesen ist, bevor er an Bord der in Bristol vor Anker liegenden Hispanola geht, wird die Muskatnussbäume einer karibischen Insel wohl kaum aus dem Stand zu identifizieren wissen. Darüber hinaus ist Hawkins ein bemerkenswert unhysterischer Erzähler. Nachdem sich die Schatzsucher im Fort verschanzt haben, wird dieses von den Meuterern angegriffen. Es kommt zu einer wilden Schießerei. Das Stöhnen der Verwundeten in den eigenen Reihen finden Hawkins und der die Expedition finanzierende Gutsherr Trelawney zwar schon verstörend, aber der Bodycount wird dann doch recht trocken rapportiert: "Von den acht Mann, die im Kampf gefallen waren, atmeten nur noch drei – der eine Pirat, der an der Schießscharte niedergeschossen worden war, Hunter und Kapitän Smollett. Und von diesen waren die beiden Ersteren so gut wie tot."
Die ultimative Bubengeschichte, die "Die Schatzinsel" darstellt, ist so etwas wie eine Coming-of-Age-Story, die weitgehend ohne Psychologie auskommt: Sind die Eltern erst einmal aus dem Weg geräumt, herrscht nur noch die fantastische Pragmatik des Abenteuers. Das Glück des Zufalls steht dem Buben bei, sogar die Gestirne und Elemente zeigen sich auf einmal von ihrer gütigen Seite und liefern Nebel und Vollmond, wann immer dergleichen vonnöten ist. Selbst das Meer verzichtet darauf, den in einem windschiefen Korakel dahinschippernden Jim zu vernichten und lässt diesen stattdessen – in den fulminanten Kapiteln 23 und 24 – einen Crashkurs in Nautik und Strömungslehre angedeihen.
Psychologisch betrachtet würden sich Jim zwei Ersatzväter anbieten. Keine der Möglichkeiten wird ergriffen. Doktor Livesey, der mit kalter Noblesse dem hippokratischen Ethos folgt, mangelt es ein wenig an affektiver Wärme, und John Silver, der nicht nur den im eigenen Enthusiasmus schmurgelnden Trelawney, sondern auch den hyperkontrollierten Livesey einzuwickeln vermag, wird durch Jims ungeplanten Lauschangriff im Apfelfass dann eben sehr schnell enttarnt.
Aber was für ein prächtiger Schurke dieser Long John Silver doch ist! Er ist der wahre Held der "Schatzinsel" – und er weiß es. "Wenn es so was wie 'nen Autor gibt", lässt Stevenson ihn in einem Dialog mit dem zutiefst anständigen, aber auch ein bissl faden Kapitän Smollett prä-poststrukturalistisch daherschwadronieren, "dann bin ich seine Lieblingsfigur."
Da hat er fraglos recht. Denn welcher Leser vermöchte sich dem Charme dieses windigen Opportunisten zu entziehen? Er ist hochintelligent und doch kein Eiszapfen (Jim mag er wohl wirklich). Er ist belesen und kultiviert und hat – im Unterschied zu Jack Londons Seewolf – seine Affekte weitgehend unter Kontrolle. Anders gesagt: John Silver verpasst der Piraterie in etwa jenen Modernisierungsschub, den Stringer Bell in "The Wire" dem Drogenhandel injiziert. Unter dem Diktat des ökonomischen Kalküls wird auf das unmittelbare Ausleben der eigenen Affekte und instantane Triebbefriedigung verzichtet. O-Ton Silver: "Heutzutage läuft's mit dem Sparen besser als mit dem Verdienen, darauf kannst du Gift nehmen."