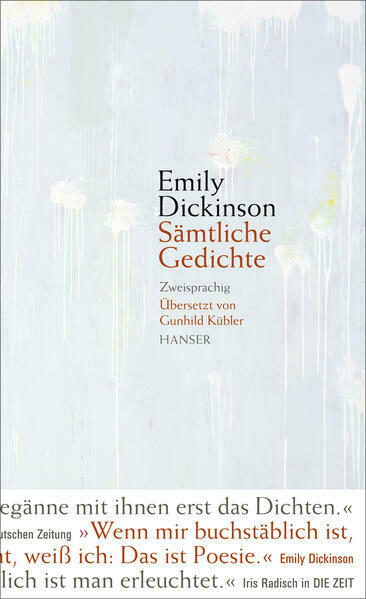"Als würde mir die Schädeldecke entfernt"
Erich Klein in FALTER 11/2015 vom 11.03.2015 (S. 21)
Zur ersten vollständigen Ausgabe der Gedichte von Emily Dickinson (1830–1886) in deutscher Übersetzung
Der Weg der 1830 in eine angesehene Familie aus Amherst, Massachusetts, geborenen Emily Dickinson schien vorgezeichnet. Der Großvater war einer der Gründer des renommierten Amherst College, der Vater zeitweiliger Kongressabgeordneter der Whig Party. Emily war wohl für die standesgemäße Heirat einer höheren Tochter bestimmt.
Stattdessen schrieb sie Gedichte wie dieses: "Mein Lieb ist wohl ein Vogel – Weil es fliegt! / Und sterblich ist es wohl – / Weil es erliegt. / Wie Bienen sticht es! / Ach, Du seltsam Lieb! / Verwirrest mich."
Sie studierte alte Sprachen, Philosophie und Naturwissenschaften und besuchte ein "Female Seminary". Im Elternhaus wurden zeitgenössische amerikanische Philosophen wie Emerson und Thoreau oder auch Darwins "Entstehung der Arten" diskutiert. Dass die junge Frau zu einer Vorläuferin der Lyrik der Moderne werden würde, war trotzdem nicht abzusehen.
Im ersten überlieferten Gedicht aus 1850 hebt die 20-Jährige noch recht konventionell an: "Ihr Musen, auf! Stimmt an den göttlichen Gesang, / dass hehres Garn sich flicht ins Valentinsgedicht!" Noch wird viel geseufzt und nach Zweisamkeit geschmachtet, bald kommen aber Selbstironie und eines der wichtigsten Motive der Dickinson – Melancholie gepaart mit Ekstatik – ins Spiel. Sie imaginiert sich als Tänzerin, bekennt aber sogleich: "Den Spitzentanz beherrsch ich nicht / Kein Mensch hat's mich gelehrt – / Doch oft ergreifet meinen Sinn / Ein solcher Übermut."
Das romantisch grundierte Understatement gerät außer Rand und Band, wenn es in "Wild Nights", über deren Sinn die Interpreten bis heute rätseln, heißt: "Sturmnächte – Sturmnächte! / Wär ich bei dir / In solchen Sturmnächten / Schwelgten wir! (
) Verankert sein – heut Nacht – / In dir!" Der Adressat dieser Wildheit ist unbekannt, eher bekannt ist, dass es dabei nicht (oder nicht nur) um Sex geht.
Bis heute unbekannt ist auch der Grund jener mysteriösen Depression, die dazu führte, dass Emily Dickinson ab ihrem 22. Lebensjahr für Jahrzehnte das eigene Haus praktisch nicht mehr verließ. Sie hält die Verbindung zur Welt stattdessen durch Briefe aufrecht. "Ein Brief ist eine Erdenfreude / Den Göttern vorenthalten", dichtete sie einmal. Dem Bruder schreibt sie übers Wetter, Freunden und Bekannten erzählt sie aus ihrem Alltag, vom Einkochen von Weingelee oder von ihrem Hund; vor allem legt sie diesen Briefen aber Gedichte bei. Ein Drittel ihrer 1800 literarischen Texte verschickte sie per Post. Zu Lebzeiten veröffentlicht Emily Dickinson ganze zehn Gedichte.
Ein wiederkehrendes Motiv ihrer quasimetaphysischen, vom traditionellen Kirchenlied ausgehenden Dichtung in kurzen Jamben sind poetische Definitionsversuche abstrakter Begriffe. "Is Heaven a physician?", wird da etwa gefragt. Ihrem Gott schneidet die Dickinson einmal die Hand ab, über den nachgerade feministisch angekratzten Allmächtigen heißt es in einem anderen Gedicht: "Freilich ist Gott neidisch – / Er kann es nicht ertragen / Dass wir uns lieber miteinander / Als mit Ihm abgeben."
Die göttliche Dreifaltigkeit wird in einer Art ketzerischen Naturreligion aufgehoben: "Im Namen der Biene – / Des Schmetterlings – / Und der Brise – Amen!" Wohlgemerkt, es handelt sich hier um ein ganzes Gedicht. Biene, Schmetterling, Brise: Mehr braucht es dafür nicht.
Die Knappheit solch literarischer Figuren, die immer mehr zu Verkürzung und zu einer Flut von Gedankenstrichen tendieren, machen die Gedichte manchmal zu regelrechten Wortanfällen. Zur Veröffentlichung waren die Texte ohnedies nicht bestimmt. In Bezug auf Publikum und Dichterruhm nahm die Dichterin eine geradezu antikapitalistische Haltung ein: "Publizieren – heißt Versteigern / Eines Menschen Geist." Doch ist Emily Dickinson nicht nur in dieser Hinsicht modern. Sie nimmt mit ihren Texten mehr als nur den freien Vers vorweg.
Ein Gedicht an den Wind liest sich eigentlich schon wie ein Vorläufer des Rap: "Der Wind kam nicht aus dem Obstgarten – heut – / Kam von weiter her! / Spielte nicht mit Heu – zog vorbei – / Ließ den Hut in Ruh – / Ein unbeständiger Kerl ist er – und sehr / Gib's zu – / Lässt Er einen Zapfen an der Tür / Auf der Tanne war er dann – das ist klar / Doch wo ist die Tanne – gib das an – / Warst du dort irgendwann?"
Dickinsons Gedichte sind keine "Naturgedichte" im herkömmlichen Sinn. Vielmehr handelt es sich um Spekulationen über Grundfragen des Lebens, über Distanz und Sympathie, Liebe und Sexualität, Angst und Hoffnung.
Thomas Higginson, einen der wenigen persönlichen Freunde, empfängt die Dickinson im August 1873, wie üblich ganz in Weiß gehüllt, in der Hand hält sie ein Büschchen Rosmarin-Seidelbast. Kommt die 43-jährige Dichterin ihm erst kindlich und manieriert vor, so verschwindet ihre Naivität, sobald es um Literatur geht. Dickinson laut Higginson: "Wenn ich ein Buch lese und mir ist, als würde mir die Schädeldecke entfernt, weiß ich: Das ist Poesie."
Eine feministische Poetik gut 50 Jahre vor Expressionismus, Dada und Surrealismus trug Dickinsons Werk den Ruf eines amerikanischen Marquis de Sade ein. Tatsächlich ist es mit zahlreichen Foltermetaphern durchsetzt: "Gewicht von Nadeln borstig – / Das stößt, und perforiert – / Damit, falls Fleisch der Wucht hält Stand – / Der Stich – Kalt insistiert (
)." Dickinsons ekstatischer Liebesdiskurs legt gnadenlos die nackte Seele bloß. Liebe sticht und verletzt.
Ein Dickinson-Bewunderer aus jüngerer Zeit, der englische Lyriker und Kritiker Ted Hughes, attestiert ihr "mystischen Furor". Die scheinbar unpolitische Dickinson habe darüber hinaus mit ihren Gedichten eine "Neuschaffung Amerikas" unternommen. Den Amerikanischen Bürgerkrieg, vor dessen blutigem Hintergrund ihr Werk entstand, habe sie ins Innere ihres poetischen, alle traditionellen Bande kappenden Systems verlegt. Wie dem auch sei, schwer zu fassen sind die Gedichte allemal.
In einem späten Gedicht voll geradezu unmenschlicher Zartheit heißt es: "To see the Summer Sky / Is Poetry, though never in a Book it lie – / True Poems flee –". An diesen äußerst komprimierten poetischen Ekstasen werden bisweilen auch die Grenze des Übersetzens deutlich: "Den Sommerhimmel sehn / Ist Poesie, mag sie auch nie in Büchern stehn – / Echte Gedichte fliehn."
Auch von der rasanten Dynamik einer Zeile wie "Take all away from me, but leave me ecstasy" bleibt im Deutschen nicht viel übrig: "Nehmt alles fort, doch lasst mir die Ekstase, / Dann bin ich reicher, als die Zeitgenossen – / Steht mir mein Reichsein an, wenn just vor meinem Heim / Die Mehrbesitzenden sind endlos arm?"
Dennoch: Gunhild Küblers Ausgabe der "Sämtlichen Gedichte" von Emily Dickinson ist eine editorische Meisterleistung, sorgfältig kommentiert und von einem ausführlichen Nachwort auch zur verwickelten Editions- und Rezeptionsgeschichte abgerundet.