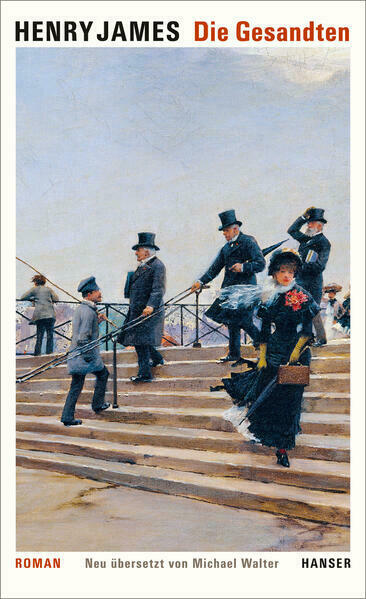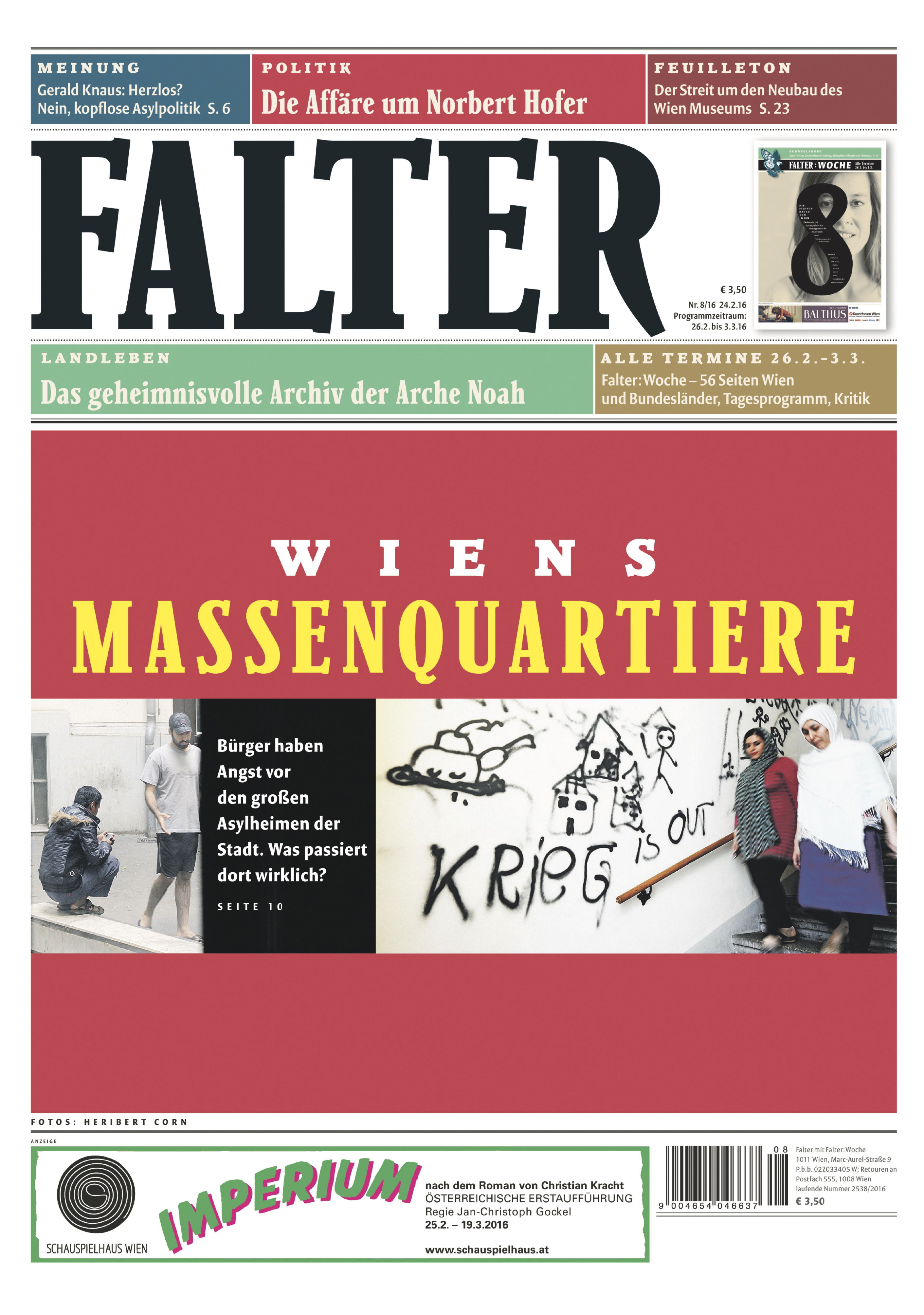
Ein Amerikaner in Paris bei Omelette und Chablis
Klaus Nüchtern in FALTER 8/2016 vom 24.02.2016 (S. 31)
Zum 100. Todestag liegt Henry James’ schillerndes Spätwerk „Die Gesandten“ in neuer Übersetzung vor
Im Leben und Werk von Henry James ist eine rege transatlantische Reisetätigkeit zu beobachten. Schon als Säugling, Kind und Jugendlicher hatte der aus New York gebürtige Schriftsteller gemeinsam mit den Eltern zahlreiche Reisen nach Europa unternommen, die mit längeren Aufenthalten verbunden waren. In seinen Romanen hat James, der am 28. Februar 1916 als britischer Staatsbürger in London verstarb, den Culture-Clash zwischen Alter und Neuer Welt immer wieder als zentrales Motiv genutzt, dabei aber durchaus unterschiedliche Akzente gesetzt.
Scheitert in „The American“ (1877) der Protagonist mit dem vielsagenden Namen Christopher Newman beim Versuch, in eine altehrwürdige französische Adelsfamilie einzuheiraten, noch an deren Borniertheit, so erweist sich ein Jahr später das titelgebende Geschwisterpaar aus „The Europeans“ als wahre Naturgewalt, welche die muffigen Gemächer ihrer freudlos verzopften Verwandtschaft tüchtig durchlüftet.
Ein Vierteljahrhundert später greift „Die Gesandten“ eine ähnliche Konstellation auf, nimmt allerdings einen Richtungswechsel vor: Diesmal besucht die Neue die Alte Welt, setzt Lambert Strethern aus dem puritanischen Neuengland über den Atlantik, um in Paris den Sohn einer vertrauten Freundin aus den Fängen vermutlich verkommener Frauen zu retten. James war sich der Abgegriffenheit dieses Topos durchaus bewusst, nutzte ihn aber ganz als Ausgangspunkt für seinen Roman, um seinen 55-jährigen Protagonisten „dem Einfluss der interessantesten aller großen Städte“ auszusetzen, gegen die der Mann aus Woollett, Massachusetts, sich denn auch nicht als gewappnet erweist.
Während dessen Freund und Reisebegleiter Waymarsh in granitener Prinzipienfestigkeit dem Charme des Kontinents und seiner Bewohner trotzt, beginnt Strethern bereits bei seiner Ankunft im englischen Chester aufzutauen, zumal die offenherzige Miss Gostrey als „eine moderne Dame von Welt ihn für die Gesellschaft flottmachte“.
In Paris schließlich, wo er das Zielobjekt seines Heimholungsauftrags zunächst nicht antrifft, ist er von dessen Freunden aus dem Quartier latin – James spielt explizit auf Henri Murgers Roman „Scènes de la Vie de Bohème“ (1851) an – durchaus angetan und bald so in Schwung gebracht, dass er feurige Predigten an die Bekehrten hält: „Leben Sie, so intensiv Sie können; alles andere ist ein Fehler. Was Sie tun, spielt eigentlich keine große Rolle, solange Sie Ihr eigenes Leben leben.“
„The Ambassadors“, wie der Roman im Original heißt, spielt mit Elementen des Entwicklungsromans, ohne selbst diesem Genre anzugehören. Das vermeintliche Früchtchen Chad Newsome, durch dessen Rückholung Strethern die Hand der Mutter, der verwitweten Mrs. Newsome, zu erringen hofft, scheint sich entgegen allen Befürchtungen längst zu einem überaus gewinnenden jungen Mann entwickelt zu haben, und der tatsächliche Held des Romans, nämlich Strethern selbst, ist bei aller melancholischen Einsicht in die Ödnis eines ungelebten Lebens schlicht zu alt, um die „graue Zentralwüste“, die der Tod seiner Frau und seines Sohnes hinterlassen haben, noch in eine Oase zu verwandeln.
Strethern wird seinen Auftrag nicht erfüllen, und der Erziehungserfolg, den Europa an Chad vollbracht haben soll, bleibt ein wenig ungewiss; das Verhältnis zu der um einiges älteren und verheirateten Comtesse de Vionnet erweist sich jedenfalls als durchaus nicht so harmlos wie stets behauptet. Allerdings werden die Themen Verrat, Intrige und Korrumpierung in den „Gesandten“ allenfalls verwendet, um das Teelöffelchen an Handlung zusammenzukriegen, das der Autor in seinen Blätterteig eingearbeitet hat.
1903 erschienen, markiert „Die Gesandten“ – gemeinsam mit dem im selben Jahr erschienenen Roman „Wings of the Dove“ – den Umbruch zu James’ Spätwerk. In diesem werden Handlung und lineare Narration durch ein Geflecht an Beobachtungen, Assoziationen und Reflexionen ersetzt, die sich in einer endlos mäandernden, von Parenthesen perforierten Syntax und üppig elaborierten Vergleichen entfalten. Das „Kopfkino“ des Lambert Strethern, wie es Herausgeber Daniel Göske in seinem luziden Nachwort nennt, ähnelt der Bewusstseinsstromtechnik, die Autoren wie James Joyce oder Virginia Woolf etablieren sollten.
Wer sich auf dieses „Drama des Differenzierens“, als das Henry James „Die Gesandten“ bezeichnet hat, einlässt, wird im Sprühnebel der Bedeutsamkeit entzückt allerlei irisierende Farbschlieren ausmachen, mitunter aber auch die Orientierung verlieren. Am allerundurchsichtigsten sind die Dialoge, in denen kaum je etwas direkt an- und ausgesprochen und der heiße Brei so lange auf Samtpfoten umschlichen wird, bis er erkaltet ist und der Leser sich fragt, wovon in Dreiteufelsnamen hier überhaupt die Rede gewesen sein soll.
Man ist dem Autor also herzlich dankbar, wenn er seinen ohnedies nicht an überschießendem Hedonismus laborierenden, gestrengen Strethern im „Klirren der Gläser, dem Brausen der Stadt und dem Plätschern der Seine“ davon entbindet, stets auf die Leinwand des Kinos im eigenen Kopf starren zu müssen, und diesem ein Debakel bereitet: „Das Debakel war ihr Spaziergang, ihr déjeuner, ihr omelette, der Chablis, das Restaurant, die Aussicht, ihre momentane Unterhaltung und sein momentanes Vergnügen daran“. Wenigstens in diesem Moment scheint es dem Helden vergönnt, sein eigenes Leben zu leben.