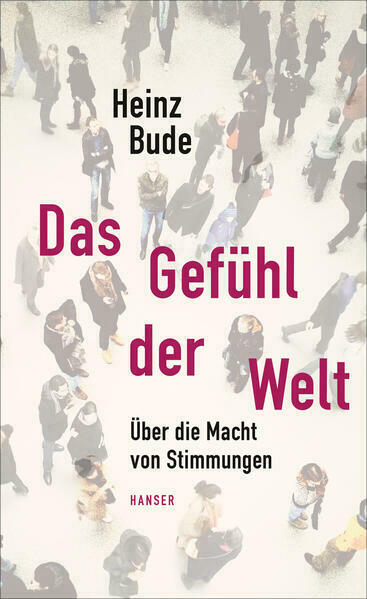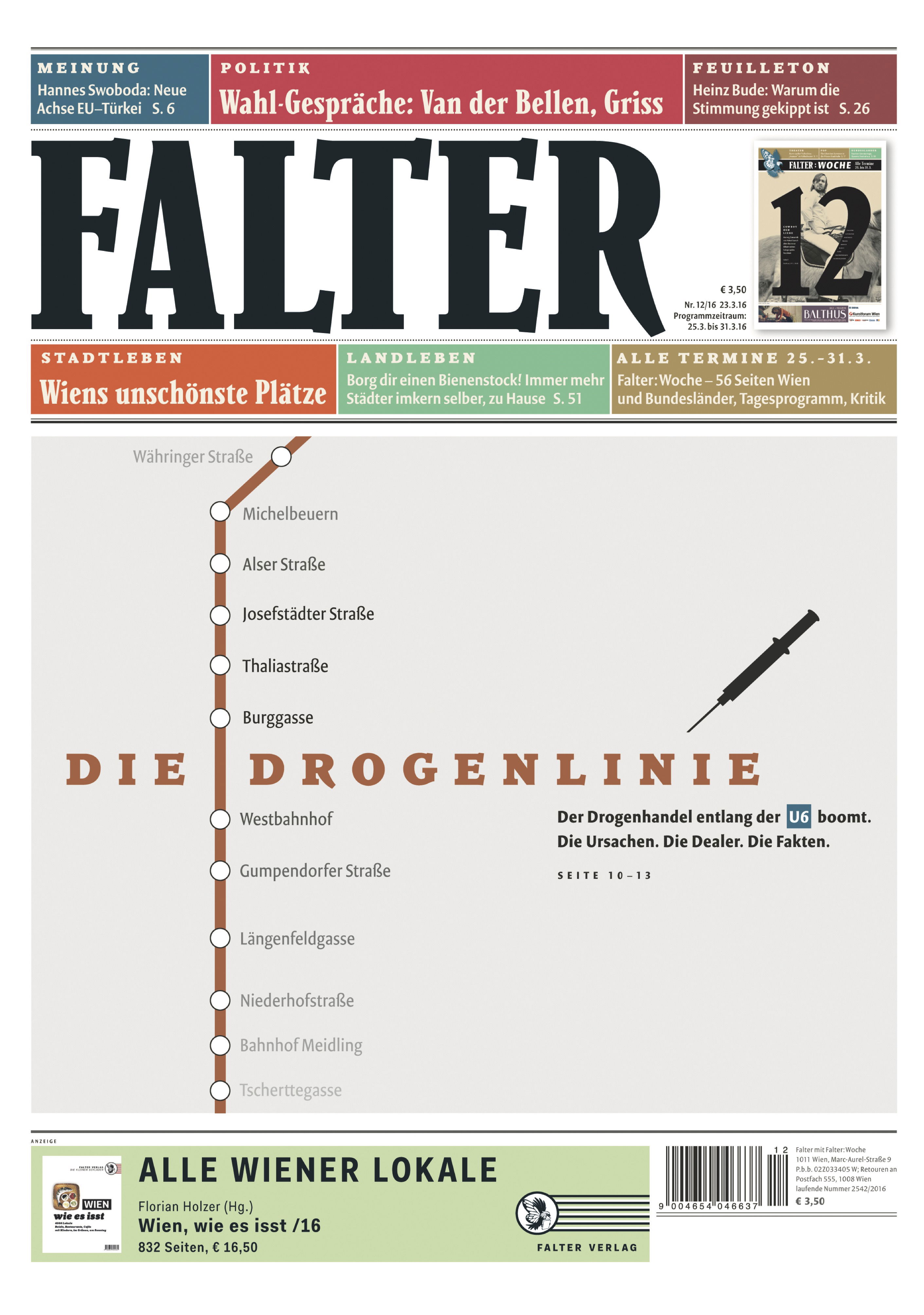
„Hoffnung ohne Optimismus ist die Stimmung der Zukunft“
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2016 vom 23.03.2016 (S. 26)
Der deutsche Soziologe Heinz Bude sieht die Chance auf einen epochalen Stimmungsumschwung, wenn es gelingt, die momentane Gereiztheit zu überwinden und die Verbitterten in die Gesellschaft zurückzuholen
Die Flüchtlingskrise, der amerikanische Vorwahlkampf, die deutschen Landtagswahlen, die Sorgen der Leute: kaum ein Kommentar oder Leitartikel zu diesen und vielen anderen Themen kommt ohne den Begriff der „Stimmung“ aus. Die Stimmung ist wahlweise euphorisch oder niedergeschlagen, sie ist vorzugsweise „am Kippen“ und ständig in Gefahr, vom Boulevard „angeheizt“ und von finsteren politischen Mächten „ausgenutzt“ zu werden.
Stimmung gilt als etwas, was die Menschen befällt und sie manipulierbar macht. Der deutsche Soziologe Heinz Bude sieht das anders. In seinem soeben erschienenen Buch „Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen“ gelangt er – unter anderem auf den Spuren des Philosophen Martin Heidegger und des Soziologen Gabriel Tarde – zu der Einsicht, dass Stimmungen nicht bloß private Empfindungs- oder kollektive Erregungszustände sind, sondern eine Voraussetzung unseres Daseins darstellen: „Sie bilden (…) als Grundton oder Gesamtfärbung des Auffassens und Erlebens eine Objektivität, die das Ich zu sich selbst herausfordert.“
Bude analysiert die Frontstellung von „heimatlosen Anti-Kapitalisten“ und „entspannten Fatalisten“ und kommt zu dem Schluss, dass die beiden Positionen „nicht auf elaborierten Weltdeutungen [beruhen], denen man mit Gegenargumenten, Inkonsistenznachweisen oder Sachverhaltskorrekturen beikommen könnte. Es handelt sich vielmehr um Haltungen zur Welt, denen eine bestimmte Stimmung in der Welt entspricht. (…) Die Stimmung gibt die Frage auf, die diese oder jene Antwort provoziert. Diese Frage stellt infrage, wie wir leben und wozu wir leben. Stimmungen sind Arten und Weisen des Daseins in der Welt.“ Der Falter besuchte Bude in dessen Berliner Wohnung und erkundigte sich nach der Stimmung in Deutschland und anderswo.
Falter: Ist es eigentlich heikel, als Soziologe über ein Thema wie „Stimmungen“ zu publizieren?
Heinz Bude: Ja klar. Weil es kein eingeführter soziologischer Begriff ist und ich mich mit einem Phänomen befasse, für das eigentlich keine Kategorie existiert, obwohl es „Stimmungen“ fraglos gibt.
In einem soziologischen Kontext denkt man bei dem Begriff sofort an „Meinungsmache“ oder „Manipulation.“
Bude: Genau das wollte ich verhindern. Es geht mir eben nicht darum, Stimmung als Täuschungsbegriff zu verwenden, sondern zu argumentieren, dass die Stimmung eine Zentrierung des Weltverhältnisses vornimmt – entsprechend dem Grundgedanken Martin Heideggers, dass jede Erkenntnis gestimmte Erkenntnis ist. Man kann auf theoretischer Ebene keinen Weltzugang postulieren, der nicht gestimmt ist.
Analog zur Einsicht Paul Watzlawicks: „You cannot not communicate“?
Bude: Genau: Man kann nicht keine Stimmung haben. In der Stimmung finden wir uns in der Welt vor, die wir selber konstruieren.
Mit Stimmung meinen Sie aber etwas anderes als die kurzlebigen Launen, die einen anfliegen, oder?
Bude: Das mit dem Anfliegen ist nicht so falsch, denn man wird ja auch mit Stimmungen konfrontiert. Wenn Sie durch einen Ort fahren, in dem gerade ein Trauerzug auf der Straße stattfindet, würden Sie normalerweise das Autoradio leiser machen. „Es mutet einen an“, wie man sagt.
Gibt es denn auch eine „longue durée“ von Stimmungen, also quasi Stimmungsepochen?
Bude: Es gibt in der Tat so etwas wie epochenspezifische Stimmungen, die man auch in unterschiedlichen Medien aufsuchen kann. Der Punk der 70er-Jahre, der mit der bleiernen Zeit der Ära von Jimmy Carter, Leonid Breschnew und Helmut Schmidt brechen wollte und dieser den Brutalismus des genialen Dilettanten entgegensetzt, markiert einen Stimmungswechsel. Wobei „No Future“ natürlich eine Kategorie der Öffnung war. Auf der anderen Seite gibt es auch die Stimmung des Augenblicks. Man konnte das in Deutschland zuletzt ja sehr schön studieren: die nervöse Euphorie des Herbstes mit seiner „Willkommenskultur“, wo natürlich auch viele die Lippen aufeinandergepresst haben und dachten: „So richtig gefallen tut mir das nicht.“
Das ist dann aber schon ein Moment, in dem Medien Stimmungen verstärken
oder abschwächen können?
Bude: Absolut. Ich versuche ja auch zu zeigen, dass im Umbruch vom 19. zum 20. Jahrhundert die Stimmung mit der Explosion der Tageszeitungen zu einer Kategorie der Medien selbst wird. Die Stimmung an der Börse, eines Landes oder einer politischen Bewegung gab es davor nicht, da war „Stimmung“ eine philosophisch-ästhetische Kategorie, die zum Beispiel bei Kant und Hofmannsthal eine große Rolle spielt.
Sie beziehen sich in Ihrem Buch stark auf den französischen Soziologen Gabriel Tarde, der offenbar gerade wiederentdeckt wird?
Bude: Ja, es gibt weltweit eine Art Tarde-Renaissance, die auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Soziologie einer psychologischen Komplettierung bedarf. Tarde war seinerzeit der große Gegenspieler von Émile Durkheim und hat diesem eine Art Mystifizierung sozialer Tatbestände vorgeworfen, wohingegen sich Tarde bemüht hat, die Vorgänge in der Masse und den Kollektiven mithilfe einer Ansteckungs- und Nachahmungstheorie zu erfassen, und er hat das eben mit der Entstehung der Massenmedien begründet.
Die was mit uns anstellen?
Bude: Wenn ich eine Zeitung lese, die mir nicht zugestellt wird, sondern die ich auf dem Boulevard kaufe, erfasst mich beim Aufschlagen die Erregung, dass jetzt gerade alle das Gleiche lesen.
The medium is the message?
Bude: Richtig. Aus der Imagination der gemeinsamen Lektüre in diesem Moment wird Stimmung zu einem medialen Phänomen, und Tarde hat daraus auch eine Theorie der Stimmungsführerschaft entwickelt, die haben nämlich die Journalisten inne. Jeder Journalist kommuniziert auch immer eine Beziehung zur Welt. Der Spiegel zum Beispiel ist ein nihilistisches Organ mit einer konstitutiven Leserverachtung, die Enzensberger sehr früh vollkommen richtig beschrieben hat. Da gibt es ein auktoriales Kollektiv, das sagt: „So ist es!“ Wohingegen die Zeit immer schon eine ernsthafte Weltzugewandtheit vertreten und den Leser vielleicht ein bisschen belehrt hat. Die FAZ liefert den Kommentar zur Lage wie eine Regierungserklärung, die Süddeutsche aber erzählt Geschichten. Tarde hatte ja die Idee, dass die Masse durch mediale Idiome geleitet wird. Das fällt im Netz natürlich weg, denn das hat kein Idiom mehr.
Dafür gibt es im Netz nicht nur imaginierte, sondern real erlebte Gleichzeitigkeit, weil jeder seine Reaktionen sofort einspeist.
Bude: Es ist ein Echtzeitmedium, das aber konstitutiv auf stellvertretende Deutung verzichtet: Den Sebastian Haffner des Netzes gibt es nicht. Und deswegen ist das Netz auch so offen für Verschwörungstheorien und dezivilisierende Affekte.
Sie schreiben davon, dass eine rund 30 Jahre währende Ära gerade zu Ende geht. Warum, und was hat sie ausgemacht?
Bude: Die Stimmung des Augenblicks ist vom Versuch bestimmt, von zwei angsthaften Besetzungen wegzukommen, die die letzten drei Jahrzehnte bestimmt haben. Das eine ist die Staatsphobie des Neoliberalismus, und das andere ist die Angst vor der Wahrheit, die wir der Postmoderne verdanken, und beide hatten sich miteinander verbündet. Diese Einstellung ist jetzt, wie ich glaube, zu einem Ende gekommen. Wobei Stimmungsanalyse immer zwei Elemente enthalten muss: Sie muss sagen, wie es uns ist, und wie es uns wird. Die Analyse ist erst vollständig, wenn man auch einen Blick dafür hat, was gerade entsteht.
Ja, sagen Sie doch!
Bude: Momentan haben wir es mit einer Stimmung der Gereiztheit zu tun: Man ist jederzeit bereit, aufeinander loszugehen. Die Ursache dafür ist meines Erachtens die Verbautheit von Zukunft, und wenn das politische Personal das nicht langsam kapiert, kriegen wir wirklich Probleme. Es klingt merkwürdig, aber wir müssen wieder zurückfinden zu einer Struktur des Versprechens. Das letzte Buch von Terry Eagleton trägt den schönen Titel „Hope without Optimism“. Das ist die Stimmung der Zukunft.
Was ein gewisses Vertrauen in Improvisationsgeschick voraussetzt.
Bude: Absolut.
Das allerdings desavouiert wird, wenn man den Satz „Es braucht eine gesamteuropäische Lösung“ zum hundertsten Mal gehört hat.
Bude: Weil uns da jemand was erzählt, von dem alle wissen, dass es nicht funktionieren wird. Es geht um in sich plausible Lösungen und nicht um die Lösung. Obamas „Yes, we can!“ würde heute nicht mehr funktionieren. Man ist ja auch gelackmeiert worden: Während Obamas Präsidentschaft hat der Rassismus zugenommen. Es ist natürlich Quatsch, ihm das anzulasten, aber man fragt sich natürlich: „Was sollte das denn? Wozu hat ,Yes, we can!‘ geführt?“ Ich glaube, dass sich die Gesellschaft wieder auf sich selbst besinnen und die sogenannte Zivilgesellschaft ihren aggressiven Anti-Elitismus aufgeben wird, also den Affekt, dass es immer nur die anderen sind. Man wird wieder akzeptieren lernen, dass die Welt ein System von Ausnahmen ist.
Wo sehen Sie Indizien für diesen Stimmungswandel?
Bude: Also in der bildenden Kunst ist es ganz klar. Da wird die Postmoderne als zynische Veranstaltung von verbitterten älteren Männern gesehen. Auf einmal gibt es wieder einen Bedarf an Schönheit. Das kommt einem, wenn man die intellektuellen Bewegungen der letzten drei Jahrzehnte mitgemacht hat, natürlich auch abgrundtief naiv vor. Aber es ist wohl so eine Art pragmatischer Idealismus, der zu seiner Naivität auch steht. Das ist allerdings insofern gefährlich, als der auch rechtspopulistisch ausgelegt werden kann: Dann wären wir wieder beim großen Wir und der Rückkehr zu Substanzbegriffen von Wahrheit und Wirklichkeit.
Und wie sollte man damit umgehen?
Bude: Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es eine intellektuelle Bereitschaft, dieses selbstgerechte, immer böser werdende Kleinbürgertum aus der Gesellschaft rauszuschmeißen. Es hat aber überhaupt keinen Sinn, sich gegen eine Gruppe moralisch gut zu fühlen, und eine konservative oder sozialdemokratische Partei kann es sich auch nicht leisten, dieses Kleinbürgertum sich selbst zu überlassen, sondern es ist eine der ganz großen Aufgaben der Zukunft, diese Verbitterten wieder einzufangen.
Wo gehören die denn, soziologisch betrachtet, hin?
Bude: 2010 meinte Christian Wulff am Tag der deutschen Einheit: „Der Islam gehört zu Deutschland“. Und wir haben uns angesehen, wer den Satz eigentlich gar nicht mag. Ergebnis war, dass ein Drittel der repräsentativ befragten Leute islamophob ist.
Was genau bedeutet das?
Bude: Nun, die sagen erstens, dass der Islam nicht zur westlichen Gesellschaft passt; sie sind zweitens der Meinung, dass man muslimische Einwanderer nicht mehr ins Land lassen soll; und sie finden drittens, dass Muslimen die öffentliche Ausübung ihres Glaubens verboten werden sollte. Wenn alle drei Auffassungen stark bejaht werden, dann würde ich sagen, sind die Betreffenden „islamophob“. Unter diesen Islamophoben, die wie gesagt 33 Prozent der Gesellschaft ausmachen, haben wir nun etwa ein Drittel selbstgerechtes Kleinbürgertum, das sich nicht stören lassen will, ein Drittel aus dem Dienstleistungsproletariat, die wissen, dass die Einwanderer Konkurrenten am Arbeitsmarkt sind, und ein weiteres Drittel von höher gebildeten, besser verdienenden, sich als „weltoffen“ bezeichnenden Leuten, bei denen sich der Spaß beim Islam aber aufhört. Das sind Leute mit sehr starker Kompetenzüberzeugung von sich selbst, mit einer hohen Bereitschaft, sich zu engagieren, die aber den Eindruck haben, dass sie nicht zum Zuge gekommen sind: Aus mir hätte sehr viel mehr werden können, wenn man mich denn gelassen hätte! Das macht Verbitterung aus: das Gefühl, dass man unter Bedingungen, die man nicht kontrollieren konnte, unter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist.
Das sind rund zehn Prozent der Bevölkerung. Wie sind die als politische Kraft einzuschätzen?
Bude: Sie sind organisationsbereit, sprechbereit und bereit, Einfluss zu nehmen. Die Ignorierten aus dem Dienstleistungsbereich gehen auf keine Demonstrationen, weil sie dafür gar keine Zeit haben, und die Selbstgerechten schauen ins Netz und bleiben zu Hause. Aber die Verbitterten machen Druck. Die sind die Klientel von Pegida, waren aber auch schon bei den Protesten gegen Stuttgart 21 dabei.
Wie hat man sich die vorzustellen?
Bude: Da fällt etwa der Typ des renitenten Ingenieurs darunter, der alles besser weiß: „Ich hab das genau durchgerechnet, aber das stimmt alles nicht. Aber mich fragt ja keiner!“ Wenn die sich mit den Ignorierten zusammentun und auch noch ein Haider-Effekt dazu kommt, sind das schon fast 25 Prozent, und dann wird es wirklich ungemütlich. Außerdem muss man auch eines bedenken: Wenn es bei uns in Deutschland zehn Prozent Verbitterte gibt, dann sind es in Frankreich bestimmt 15, wenn nicht mehr. Das sind nämlich all die Leute, die beim Umbau der öffentlichen Verwaltung, von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder den Firmenbürokratien degradiert wurden. Und das sind nicht notwendig Ältere, das können auch Leute Mitte 30 sein.
Und wie wollen Sie die nun „einfangen“?
Bude: Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Man muss ihnen bloß sagen: „Jetzt erzähl mir doch, was mit dir los ist.“ Auf diese Weise hat ja Obama seinen zweiten Wahlkampf gewonnen. Die haben sich die Daten und Adressen jener rausgesucht, die Wechselwähler sein könnten und haben bei denen geklingelt: „Wir kommen von Barack und wollten wissen, was du dir eigentlich denkst!“ Und dann hat man sie erzählen lassen.
Zur Stimmung gehört immer auch der Umschwung und das Kippen der Stimmung. Wie geht das vor sich?
Bude: Es gibt das relativ einfache Modell der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann, das ich ganz interessant finde. Stimmung ist immer herrschende Stimmung, was aber auch heißt, dass es Leute gibt, die nicht in dieser Stimmung sind. Das sind die, die den Mund halten und den Stimmungsführern in den kleinen Lebenskreisen erst mal folgen, weil sie nicht als Stimmungsverderber dastehen wollen, und möglicherweise diejenigen, die den Mund voll nehmen, auch ein bisschen bewundern.
Und wann treten diese Leute aus der Schweigespirale?
Bude: Das ist in Deutschland erst unlängst in dem Moment passiert, in dem man sich dachte: Wir sind in Europa isoliert.
Was nicht falsch ist.
Bude: Was nicht falsch ist und wo dann alle zugeben müssen, dass Deutschland doch nicht der stille Hegemon Europas ist. Dann kommen die aus der Schweigespirale raus und sagen: „Haben wir ja immer schon gesagt!“ Und sie haben recht. Es hat die Kölner Silvesternacht gegeben, und es stimmt, dass sie bagatellisiert wurde, und es stimmt auch, dass es nicht nur Flüchtlinge gibt, die ihr Leben retten oder ihr Glück machen wollen, sondern auch solche, die unsere Gesellschaft in einer Weise ändern wollen, die wir nun gar nicht gut finden. Und von einer „gesamteuropäischen Lösung“ kann natürlich gar keine Rede sein. In Österreich macht ein sozialdemokratischer Bundeskanzler die Grenze zu! Sogar in Schweden haben sie dichtgemacht, nur wir in Deutschland lassen die offen?! Kann doch nicht sein. Das ist der Status quo, und wenn sich die Rechtspopulisten jetzt festsetzen, bleiben die auch. Das ist dann europäische Normalität. Meine Frau hat unlängst mit einem linksliberalen Franzosen gesprochen, der nach dem dritten Glas Wein meinte: „Ich kann die Leute verstehen, die den Front National wählen.“
Aber irgendwie muss man sich die Affekte der Leute ja erklären, einfach zu sagen,
dass die alle ein Rad ab haben, hilft ja
auch nicht weiter.
Bude: Deswegen finde ich ja „Stimmung“ eine so brauchbare Kategorie, weil die jenseits von „alles Spinner“ angesiedelt ist.
Der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz meinte Anfang Februar, es
herrsche eine „Pogromstimmung“,
die „kreuzgefährlich“ sei.
Bude: Ja, es herrscht eine polarisierte Stimmung, und Angela Merkel ist nicht diejenige, die zur Entspannung beitragen kann. Es gibt nur zwei Politiker, von denen man meint, dass sie es vielleicht könnten: Winfried Kretschmann, ein grüner Katholik, der sagt: „Es gibt noch was anderes als Politik.“ Das finden die Leute plötzlich total gut. Und der andere ist Frank-Walter Steinmeier, weil der zu allen Schurken geht, und man denkt: Der ist keine Heulsuse, sondern Realist. Es gibt viele Merkel-Bewunderer, auch aus dem linksliberalen Bereich, die sich jetzt sorgen, nicht, ob sie die Flüchtlingskrise managen, sondern ob sie die Stimmungen wieder zusammenführen kann. Sogar in meine Sprechstunde kommen Studierende, die sagen: „Herr Bude, was ist los bei uns? Ein Freund von mir sagt auf einmal Sachen – ich weiß gar nicht, was in den gefahren ist. Ist das jetzt ein Nazi?“ Da muss man dann immer ruhig bleiben und sagen: „Ich krieg das schon für Sie zusammen.“
Hätte Angela Merkel ein anderes „Wording“ finden müssen? Die Frage, die sich zu „Wir schaffen das!“ aufdrängt, lautet ja schon: „Warum eigentlich? Und wie?“
Bude: Merkel hat nie behauptet, dass es keine Probleme gibt. Was sie verabsäumt hat, war mitzukommunizieren, dass man auch scheitern kann. Der bayerische Innenminister, mit dem man vernünftig reden kann, hat das in einem Gespräch sehr schön umschrieben: „In Bayern haben wir Flüchtlinge im Ausmaß der Einwohnerzahl von Würzburg. Ein Würzburg kriegen wir hin, vielleicht sogar zwei – aber ganz sicher nicht drei.“ Darum geht’s. Um eine Logik der Erwartbarkeit, und Angela Merkel hat die Spanne der Unerwartbarkeit zu weit ausgedehnt. Natürlich muss man Zahlen nennen! Was denn sonst?!
Dann kommt aber die Sprachpolizei der Wohlgesinnten und verbietet die Verwendung des „O-Wortes“: Auf
keinen Fall „Obergrenze“ sagen!
Bude: Wenn es die nicht gäbe, die ständig „Obergrenze“ sagen, dann wär’s gut. Nein, das wär überhaupt nicht gut!
Welche Aufgaben stellen sich angesichts der polarisierten Stimmung den Intellektuellen?
Bude: Es bräuchte so etwas wie einen libertinären Paternalismus. Man muss offen sein und zugleich sagen: „Es wird schon.“ Intellektuelle müssen sich Klarheit darüber verschaffen, dass auch ihre Deutungen ein Versprechen enthalten. Man kann nicht immer nur Szenarien entwickeln, sondern muss kontrollierte Versprechen abgeben. Und man kann den Anti-Elitismus nur bändigen, indem man die Leute ernst nimmt.