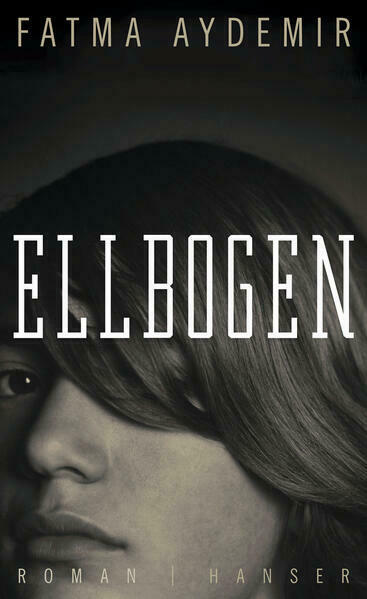Lieber eine böse Bitch als bieder und brav
Sigrid Löffler in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 8)
In ihrem Debütroman „Ellbogen“ bemüht sich Fatma Aydemir um Unterschichten-Authentizität. Aber geht sich das aus?
Wenn eine türkischstämmige Journalistin wie die taz-Redakteurin Fatma Aydemir die Tochter türkischer Gastarbeiter aus dem Berliner Zuwandererbezirk Wedding zur Heldin und Ich-Erzählerin ihres Debütromans macht, dann stellt sich sofort die Frage: Was für eine Sprache wird sie dieser in den Mund legen?
Hazal ist 18, Tochter eines Taxifahrers, der sie schlägt, und einer geduckten, depressiven Mutter, die türkische Fernsehserien schaut und dem Mädchen das Ausgehen und auch sonst fast alles verbietet. Wütend absolviert Hazal eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Wütend jobbt sie in der Bäckerei eines Onkels. Sie weiß zwar nicht, was sie will, aber sie weiß, was sie nicht will: „Das brave türkische Mädchen spielen und irgendwann den Sohn irgendeines beschissenen Nachbarn heiraten und mich mit Goldschmuck behängen lassen.“
Während Hazals Mutter ständig fürchtet, dass die Tochter ihr Leben verpfuscht, sind sich Hazal und ihre Freundinnen Elma, Gül und Ebru einig: „Wir haben keinen Bock darauf, nach außen immer voll brav zu tun und alles, was Spaß macht, immer nur heimlich zu machen.“ Beispielsweise: Gras rauchen, Wodka trinken, auf Facebook mit jungen Männern anbandeln, sich nuttig schminken, einen Technoclub besuchen.
Fatma Aydemir, die selbst nicht im Problemviertel Wedding, sondern in Karlsruhe geboren wurde und in Frankfurt Germanistik und Amerikanistik studierte, hat sich für ihre Heldin den aus den Medien geläufigen großmäuligen Machojargon türkischer Jungen zugelegt: „Laut, unverschämt und grundlos aggressiv“. In der Rede der Mädchen wimmelt es von Schimpfwörtern wie „Spasti“ und „Opfer“. Deutsche heißen bei ihnen „Kartoffeln“ und über Frauen reden sie so verächtlich wie der mieseste Gangsta-Rapper: „Nutte“, „Schlampe“, „Bitch“. Die Frage ist nur: Borgt sich Hazal hier mangels eigener Stimme die aggressive Stummelsprache abgehängter Jugendlicher oder ist es die Akademikerin Aydemir, die hier alle angesagten Prollklischees imitiert, die sie bei der türkischstämmigen Unterschichtjugend vermutet? Zu fürchten ist: vermutlich doch eher Letzteres.
„Ellbogen“ ist der Roman einer Journalistin. Das erkennt man schon daran, dass alle einschlägigen und aus den Medien bekannten aktuellen Vorfälle meinungsstarke Erwähnung finden: von der Silvesternacht in Köln bis zum Putschversuch gegen Erdoğan, vom IS-Terror bis zu den Kurden-Unruhen und von Charlie Hebdo bis zur Flüchtlingskrise. Hier spricht wohl weniger die dumpf brodelnde Heldin als eher Fatma Aydemir selbst, die da ihre wache politische Kompetenz paradiert.
Hinzu kommt das bemühte Einstreuen aller themenrelevanten Stichworte, die sich mit einer wütenden und auf Krawall gebürsteten jungen Deutschtürkin aktuell verbinden lassen: Ladendiebstahl, provokantes Gehabe, Anstänkern blonder Bürgerstöchter auf der Straße, Attackieren eines Zufallspassanten auf einem nächtlichen U-Bahn-Steig – leider mit Todesfolge. Hazals Freundinnen kommen in U-Haft, dank Überwachungskamera und Handyvideo; Hazal flüchtet nach Istanbul und versteckt sich bei einem aus Deutschland abgeschobenen Türken, den sie auf Facebook kennengelernt hat. Sie ist jetzt eine gesuchte Mörderin, doch sie will sich nicht stellen, denn sie fühlt keine Reue.
Der Roman hat zwei Teile und zwei Schauplätze, Berlin und Istanbul. In Berlin fühlt sich Hazal fremd, unfrei, benachteiligt und von allen ungerecht behandelt: vom Gehorsamsregime ihrer traditionsverhafteten Eltern ebenso wie von den „Kartoffeln“, bei denen sie ständig unterschwellige Vorurteile wittert, manchmal sogar zu Recht. Doch auf andere Weise fremdelt Hazal auch in Istanbul. Zugehörig kann sie sich auch hier nicht fühlen, dafür hat ihr mangelhaftes Türkisch einen zu starken deutschen Akzent. Ahnungslos stolpert sie in einen Kreis revolutionär aufgewühlter Studenten und sieht sich dann, verpeilt, wie sie ist, den Panzern in der Istanbuler Putschnacht gegenüber.
Fatma Aydemir kann geläufig erzählen. Die Kunst, einen Roman triftig zu beenden, beherrscht sie nicht. Dafür, Kontingenz in Notwendigkeit zu überführen, reichen ihre künstlerischen Mittel (noch) nicht aus.