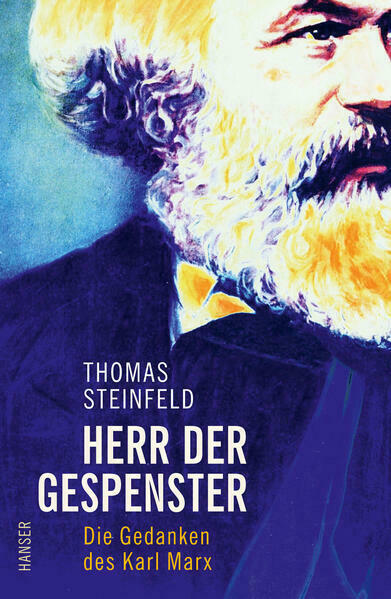Marx forever: eine endlose Interpretation
Alfred Pfabigan in FALTER 41/2017 vom 11.10.2017 (S. 47)
Biografie: Vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. An seinem Leben und Werk arbeiten sich drei Bücher ab
Wer 150 Jahre nach Publikation seines Hauptwerks und nahe an seinem 200. Geburtstag noch immer im Zentrum eines intensiven Diskurses steht, der hat sich ein Plätzchen im Olymp erobert. Ob Marx diesen Platz verdient und wie er ihn erreicht hat, darüber streiten sich die Parteiungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts – ebenso wie über die Frage, wie er richtig auszulegen ist.
An Biografien und Büchern zum Thema „Was Marx wirklich sagte“ herrschte also seit dem Revisionismusstreit in der deutschen Sozialdemokratie kein Mangel; in den Jahren von Eurokommunismus, studentischem Marxismus und anderen sich bekämpfenden Fraktionen der Linken hatten diese Bücher eine neue Konjunktur. Nicht zu vergessen die biederen Marx-Bilder aus der Werkstatt der Sowjetunion und ihrer Satelliten, aber auch kulturelle Erzeugnisse des Kalten Krieges, die ihn für die russische Mischung aus Gulag und Misswirtschaft verantwortlich machten.
War Marx ein Prophet?
Heute, speziell seit 2008, dominiert im öffentlichen Leben eine vulgäre Interpretation von Marx als einem, der alles vorhergesehen hat – der Bogen reicht vom Zusammenbruch der Lehman-Bank bis zum Klimawandel – und der als guter Mensch den Kapitalismus ob seiner Ungerechtigkeit gehasst hat.
Ganz so war es nicht, doch wer Marx so sehen will, der ist mit der Marx-Biografie des Bestseller-Autors Jürgen Neffe mit dem Titel „Marx. Der Unvollendete“ gut bedient. Unter einem Motto von Willy Brandt und Berufung auf die Zeit wird uns Marx als einer beschrieben, der selbst die Gier der Manager vorhergesehen hat. Doch: Hatten Manager damals schon dieselbe Bedeutung wie heute, und hat Marx sich nicht eher mit den Tendenzen des letztlich anonymen Kapitals und dem Einzelkapitalisten befasst?
Kann man sagen, dass Occupy-Aktivisten die Forderung des Frühsozialisten Henri Saint-Simon „heute noch unterschreiben“ könnten, dass nur denen Einkommen zustünden, die tatsächlich arbeiten? Das schlägt sich irgendwie mit der populären Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Braucht man für eine derartige Weltsicht den komplizierten Marx – oder würde da der von ihm kritisierte Proudhon mit seiner biederen Parole „Eigentum ist Diebstahl“ nicht ausreichen?
Jedenfalls: Bei Neffe tritt sich einiges auf die Füße. Terror und Gewalt sind bei Marx oft positiv konnotiert – aber er hätte doch, so Neffe, vom sinnlosen Blutvergießen abgeraten, vor allem, wenn die Zeit noch nicht reif sei. Gibt es einen ernst zu nehmenden politischen Theoretiker, der für „sinnloses Blutvergießen“ plädiert hat? Marx’ zentrales Thema sei das „freie Wort“ gewesen. Nur: wessen? Wer dem Mann widersprach, hatte es mit einem arroganten, intriganten und tyrannischen Rechthaber zu tun.
Hagiografie in DDR-Manier
Manche persönlichen Beschreibungen der Lebensführung Marx’ grenzen an den Kitsch der DDR-Hagiografen: Die Ehe mit Jenny von Westphalen verlief, sagen wir einmal taktvoll, dem Zeitgeist entsprechend. Die Gattin musste die unleserlichen Notizen ihres Mannes transkribieren und hatte die peinlichen Verhandlungen mit Fleischern und Hausherren zu führen, weil nie Geld da war.
Und als sie – schwanger – auf einer erfolglosen Bettelreise in Holland war, schwängerte der Gatte nach feudaler Manier das Dienstmädchen; zur Wahrung der Reputation schob man die Sache dem Freund Friedrich Engels zu. Doch wer nicht sieht, so Neffe, dass hier „Zuneigung in gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz“ vorlag, der hat „womöglich selbst nie die gleichberechtigte Liebe in einer Ehe“ erfahren.
Neu ist, dass die Krankengeschichte des leidenden Marx – Furunkel, Leberleiden, Rheuma – mit all ihren quälenden und ekligen Implikationen noch nirgends so genau erzählt wurde. Allerdings: Marx war ein exzessiver Raucher, trank und scheint recht oft zum Opium gegriffen zu haben. Schade ist der gelegentliche Rechercheverzicht – die „Erinnerungen“ des Anarchisten Bakunin, im Original ein Fragment, „Persönliche Beziehungen zu Marx“ betitelt, werden nur aus der nicht wirklich zuverlässigen Marx-Biografie von Fritz J. Raddatz zitiert; was Bakunin betrifft, wird dessen „Staatlichkeit und Anarchie“, im anarchistischen Karin-Kramer-Verlag und bei Ullstein publiziert, dem ostdeutschen Dietz-Verlag zugeschrieben; möglich – aber auffindbar ist die Ausgabe nicht.
Marx im Kontext verstehen
Die Marx-Exegese ist seit über 100 Jahren zu einer Art akademischer Disziplin geworden. Die das Denken hemmende Frage, ob Marx denn „recht hatte“, spielt in Gareth Stedman Jones Biografie keine Rolle. Der Autor, lange Zeit Mitherausgeber der New Left Review, danach Professor für Ideengeschichte in London und Cambridge, setzt Marx in den Kontext der sorgfältig rekonstruierten philosophischen, ökonomischen und politischen Debatten seiner Zeit.
Und siehe da: Kontextualisiert man sie, dann hatten manche Kategorien für Marx eine ganz andere Bedeutung als in der heutigen umgangssprachlichen Verwendung. Man lernt Überraschendes: Es war Christian Wolff, zwischen Gottfried Leibniz und Immanuel Kant der bedeutendste deutsche Philosoph, der die Idee vertrat, der Staat solle für Verteidigung, Wohlergehen und Glück der Untertanen verantwortlich sein – und damit jenen Wohlfahrtsstaat konzipierte, dessen Ausweitung viele mit scheinbar Marx’schen Argumenten heute fordern. Ganz so, als ob Marx ein Idealist gewesen wäre.
Als Kommentator übt Stedman Jones im Regelfall Zurückhaltung – mit einer Ausnahme, der Anprangerung antisemitischer Klischees in der berüchtigten Schrift „Zur Judenfrage“. Viele Interpreten meinen ja apologetisch, es sei Marx hier „nur“ um den Juden als Kapitalisten gegangen. Die zahlreichen antisemitischen Invektiven im von den Marx-Töchtern gesäuberten Briefwechsel mit Engels widerlegen das – dass der Rivale Ferdinand Lassalle als „jüdischer Nigger“ firmierte, hat nichts mit dem Kapitalismus zu tun.
Wichtig für das Verständnis der Inkohärenz der politischen Schriften von Karl Marx rund um 1848 ist Stedman-Jones’ Analyse, dass dieser gleichzeitig auf zwei Pferde setzte: die aktuelle, bürgerlich-demokratische Revolution und die proletarisch sozialistische.
Der Kapitalismus und das Kapital
Einen Bruch im Denken Marx’ registriert auch Thomas Steinfeld, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Professor an der Universität Luzern. Sein Versuch, Marx zu verstehen, steht unter dem Motto, dass es leicht – und, sei hinzugefügt, populär – sei, dem Kapitalismus schlechte Dinge nachzusagen. Das war aber nicht das primäre Anliegen Marx’ – als Wissenschafter versuchte er die Bewegungen des Kapitals zu verstehen.
Er sei allerdings auch ein Revolutionär gewesen, der mit wechselndem Engagement die Widersprüche und die ihm wissenschaftlich selbstverständlichen selbstzerstörerischen Tendenzen unseres ökonomischen Systems angeprangert habe. Und damit gehören die pathetischen, leidenschaftlichen Anklagen und die Aufrufe zur gewalttätigen Aktion einfach zur widersprüchlichen Gesamtperson. Auch sollte man nicht vergessen, dass viele moralische Mängel des Kapitalismus von Marx nicht kritisiert, sondern einfach im Kontext der Profitmaximierung vorausgesetzt wurden.
Auch Steinfeld kontextualisiert Marx, aber er bietet keine zeitliche Rekonstruktion der „Entwicklung“ der Marx’schen
Ideen und keinen Nachvollzug der eine hohe Kompetenz erfordernden Unterschiede zu den philosophischen und ökonomischen Vorgängern. Seine Rekonstruktion verwirft auch die langatmigen empirischen Befunde aus dem 19. Jahrhundert und erteilt der Zukunftsvision eine Absage: Kritik ist auf ein Jenseits nicht angewiesen.
Marx, Madame Bovary und Vampire
Es ist ein essayistisches Herangehen, in dem Steinfeld viel Mühe darauf verwendet, spekulativ das verschollene Selbstverständnis Marx’ beispielsweise aus der schönen Literatur der Zeit zu rekonstruieren. Erschließt uns Gustave Flaubert in der „Erziehung des Herzens“ nicht die damaligen existentiellen Vorstellungen von „Revolution“ besser als die Berichte über die Oktoberrevolution, die sich auf Marx berief? Und hilft die „Madame Bovary“ desselben Autors nicht, die rätselhafte Kategorie vom „Fetischcharakter der Ware“ zu verstehen? Und wieso hat Marx mit schiefen Bildern, wie etwa dem von Basis und Überbau, Erfolg gehabt – und mit seiner Hegel‘schen „heftigen Neigung zum Genitiv“?
Wieso verwendet der leidenschaftliche Leser von Gruselromanen so gerne die „Vampir“-Metapher? Und schließlich: War er nicht auch ein Ironiker, der Hegel bewusst falsch zitierte? Einer Diskussion mit einem akademischen Marxisten und seinen Ableitungen wird man aus der Lektüre dieses Buches nicht gewachsen sein – aber es bringt einem Marx auf eine leichte, originelle und dennoch anspruchsvolle Weise näher.