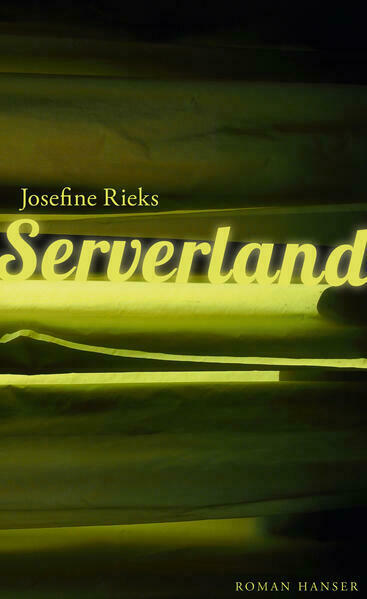Wenn der Laptop ein Fall für die Archäologie wird
Karin Cerny in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 19)
In Josefine Rieks’ Dystopie „Serverland“ verklärt eine Gruppe von Computer-Nerds die Zeit, in der es noch das Internet gab
Sie wähnen sich als Archäologen, die gerade die Reste einer bedeutenden Kultur ausgraben: „So mussten sich Forscher beim Betreten der Bibliothek von Alexandria gefühlt haben“, rauscht es Rainer, der bei der Deutschen Post arbeitet, nicht sonderlich viele Freunde hat und das klassische Bild eines Computer-Nerds abgibt, durch die Birne, als er eine stillgelegte Fabrikhalle betritt. Dabei steht er bloß vor ausrangierten Google-Servern.
Rainer, der Protagonist aus Josefine Rieks Debüt „Serverland“, ist Mitte 20 und sein größtes Problem ist: Computer gibt es eigentlich gar keine mehr, das Internet wurde schon vor Jahrzehnten abgedreht, seitdem ranken sich urbane Legenden darum. Einige Freaks spielen illegal alte Computerspiele. MacBook-Laptops sind nur mehr als Elektroschrott aus der Vergangenheit beim Trödler erhältlich.
Die in Berlin lebende Rieks, Jahrgang 1988, legt einen Science-Fiction-Roman vor, der unsere Gegenwart aus der Zukunftsperspektive unter die Lupe nimmt. Wie wird man auf unsere online-verrückte Welt später einmal blicken: Sieht man den Hass, der im Netz geschürt wurde? Was erscheint banal, was hat Bedeutung inmitten der unzähligen tagtäglichen Äußerungen im Netz?
Gerade der naive Blick ihrer Protagonisten, die einfach alles genial finden, was sie an historischem Material aus Youtube und Facebook ihrer Eltern herunterladen, macht den Reiz des Romans aus, der am Ende auch alle Quellen auflistet. Abgehandelt werden der Alltag eines jungen Manns, der im Zoo vor dem Elefantengehege steht, Influencer-Egozentrik, alkoholisierte Bundestagesreden, der perfekte No-Make-up-Look und die dringliche Frage, wie man das Motorengeheul eines Lamborghini stimmlich imitieren kann.
Sobald der abgedrehte Server von Rainer mithilfe einer Autobatterie erneut gestartet wird, finden sich schnell Gleichgesinnte aus aller Welt, die eine neue Jugendbewegung gründen wollen. Die Daten im Netz stehen aus ihrer Sicht für die Freiheit einer Gesellschaft, die alles miteinander geteilt hat; die Sachen ins Netz gestellt hat, ohne Geld dafür zu verlangen; Wissen großzügig für alle zugänglich gemacht hat. Was hatten sie sich davon erhofft? War es eine kommunistische Vision? War es eine bessere Welt, in der echte Rede- und Gedankenfreiheit herrschte?
Jeder Online-Fund wird ausgiebig analysiert und diskutiert. War Robbie Williams Musikvideo „Rock DJ“ aus dem Jahr 2000, in dem der Pop-Entertainer nicht nur strippt, bis er völlig nackt ist, sondern sich auch noch die Haut vom Leib reißt, ein feministisches Statement? Denn auch Musikvideos kennt man in dieser Epoche der Zukunft nur vom Hörensagen.
Rieks’ popkulturell gesättigter Witz funktioniert über lange Strecken ziemlich gut. Zudem gelingt es der Autorin, minutiös und glaubhaft zu beschreiben, wie sich die neue pseudopolitische Bewegung im täglichen Kleinkrieg selbst zerstört. Die jungen Rebellen suchen nach einer gerechten, freien Gesellschaft, scheitern aber am Alltag. Die einen wollen Party machen, die anderen lassen sich von den Videos einfach berieseln. Rainer möchte eigentlich kein Anführer sein, und jene, die sich dazu berufen fühlen, verheddern sich in Liebesgeschichten und eitlen Posen. Die Revolution muss – trotz Internet – warten. So weit, so pointiert.
Zugleich lässt Rieks ihre Leserschaft im Dunklen darüber, wie diese Zukunft ohne Internet denn konkret aussieht. Vom Leben abseits der schrulligen Aussteiger erfahren wir nichts. Das macht ihr Buch ziemlich abstrakt, es hängt quasi in der Luft. Die Bedrohung durch den Staat, der anscheinend die Zentralgewalt über alle Nachrichten hat, bleibt vage. Obwohl die Jugendlichen ständig lautstark feiern, kommt nie die Polizei vorbei. Als Dystopie eines analogen Überwachungsstaates taugt der Roman daher nur bedingt. Warum das Internet endgültig abgedreht wurde, ist nur kurz angedeutet: Die Aktion war wohl eine Reaktion auf die Anschläge von 9/11. Es gab zwei Jahrzehnte später ein „Referendum über den Shutdown“.
„Serverland“ wirft einen originellen Blick auf die digitalen Blasen unserer Tage: Wir würden ja gerne politischer sein, aber die neueste TV-Serie muss auch gestreamt werden. Das Internet hätte jede Menge kritisches Potenzial, aber wir verschwenden unsere Zeit damit, uns mit banaler Unterhaltung zu amüsieren. Ganz so bieder ist die Botschaft freilich nicht, denn eines macht der Roman auch deutlich: Ohne Youtube-Videos wäre das Leben auch nicht besser.