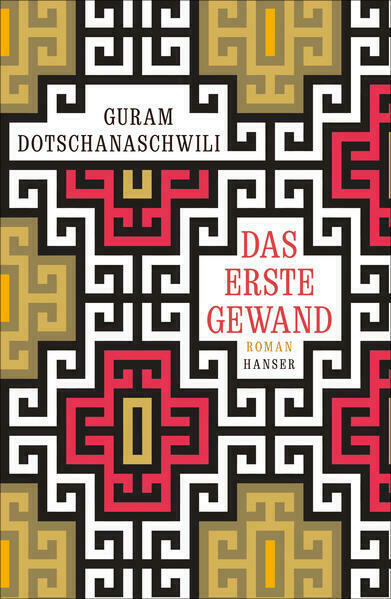Stolpern über einen bunten Teppich
Kirstin Breitenfellner in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 11)
Guram Dotschanaschwilis „Das erste Gewand“ (1978) ist das Lieblingsbuch der Georgier. Aber warum?
Guram Dotschanaschwilis monumentales Epos „Das erste Gewand“ gilt als Parabel über die politische Tyrannei. Als solche bleibt es so allgemein, dass keine Kenntnisse der Gewaltherrschaft der Sowjets im Allgemeinen und ihrer Ausprägung in der Teilrepublik Georgien im Besonderen erforderlich sind, um seine Symbolik zu entschlüsseln. Da sich von der georgischen Nomenklatura offenbar niemand wiedererkannt hat, konnte der Roman, an dem der 1939 in Tiflis geborene Autor seit 1966 gearbeitet hatte, 1978 erscheinen. Das Buch avancierte zum Kultroman einer ganzen Generation und zum meistgelesenen Buch Georgiens. 2014 wurde es bei einer Umfrage der Fernsehsendung „Chemi zigni“ (Mein Buch) mit großem Vorsprung zum Lieblingsbuch der Nation gewählt.
Die Übersetzung ins Russische war Ende der 1970er-Jahre nur möglich gewesen, weil die Übersetzerin die „gefährlichen Stellen“ des Textes weggelassen hatte, worauf die zuständige Kommission diesen als Kriminal- und Abenteuerliteratur klassifizierte. Erst nach der Perestroika konnte er unzensiert erscheinen.
Dass der Roman den Kampf um Freiheit zum Thema machte, war in der Sowjetunion davor, wo man offiziell bereits auf dem Gipfel der Freiheit lebte, ein absolutes Tabu gewesen. Es bedurfte also einiger Fantasieanstrengung seitens des Autors, die Geschichte so zu erzählen, dass ihr politischer Gehalt nicht zu offenkundig zutage trat. Dotschanaschwili verlegte die Handlung in eine nicht näher bestimmte Zeit und ein von archaischen Sitten und Gebräuchen geprägtes Dorf.
Schon auf den ersten Seiten nimmt einen der Roman durch seine feinen Beobachtungen, seine plastischen Beschreibungen und seine geschliffene Dialogkunst gefangen. Er schildert die Ankunft eines Flüchtlings in dieser abgeschotteten Welt, dessen Geschichten den Protagonisten des Romans, den 17-jährigen Domenico, dazu anregen, sich sein Erbe auszahlen zu lassen und in die Welt zu ziehen. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohns aus dem Lukas-Evangelium. Domenico muss denn auch als Schweinehirt arbeiten, bevor er nach seiner Rückkehr ins Dorf das titelgebende erste Gewand, ein edelsteindurchwirktes Ornat, verbrennen und zu einer entscheidenden Erkenntnis gelangen wird.
Die Stationen dieser Heimkehr sind allesamt allegorische Orte: Zuerst kommt Domenico nach Feinstadt, in ein Städtchen mit pastellfarbenen Häusern, in dem niemand zu arbeiten scheint, dessen Bewohner einem oberflächlichen Hedonismus und Eskapismus anhängen. Durch die attraktive, aber heiratsunwillige dunkelhaarige Theresa lernt er die Sexualität, durch die stets weiß gekleidete Musikerin Ana Maria die Liebe kennen.
Obwohl allerhand passiert, stellt sich bei der Lektüre aber schon bald Ermüdung ein, denn eine Handlung im herkömmlichen Sinne gibt es so wenig wie eine psychologische Entwicklung des naiven Helden. Man ist erleichtert, als sich Domenico endlich in eine neue Stadt aufmacht. Hier in Kamora herrschen Willkür, Verrat, Folter und Mord. Alles ist „mit Misstrauen und Blut getränkt“, die Schergen des Tyrannen Marschall Bittencourt tragen schwarze Umhänge und Holzmasken mit Augenschlitzen.
Zum Schluss schließt sich Domenico den Freiheitskämpfern der Lehmstadt Canudos an (eine Anspielung auf den Aufstand in der gleichnamigen brasilianischen Stadt 1896–97). Um den Widerstand der Rebellen aus Canudos zu brechen, vergiften die Kamoraner den Fluss. Es kommt zum finalen Kampf.
Dotschanaschwilis erklärte Absicht ist es, „bunte Geschichten wie einen Teppich“ zu den Füßen der Leserschaft auszubreiten und er fordert diese direkt auf, davon Gebrauch zu machen: „Bitte laufen Sie doch drüber“. Dotschanaschwili ist ein sprachgewaltiger Autor, das spürt man in jeder Zeile, auch wenn die formidable Übersetzung von Susanne Kihm und Nikolos Lomtadze nur einen unvollständigen Eindruck von der Innovationskraft seiner Sprache zu vermitteln vermag. Viele der Neologismen und Wortumdeutungen sind, so kann man dem Begleitheft entnehmen, in die georgische Alltagssprache eingegangen.
In einem Interview zeigte sich Dotschanaschwili mit einem „Faust“-Zitat auch augenzwinkernd versöhnt mit den widrigen Produktionsbedingungen, unter denen sein Roman entstanden ist: „Bei den damaligen Zensoren will ich mich, ungeachtet ihrer Unbarmherzigkeit und Kaltherzigkeit, herzlichst bedanken für ihre Gemeinheit, die uns dazu zwang, geschicktere Ausdrucksformen zu finden. Dank ihnen haben wir emsig an unserem Stil gewoben. Sehr gebildet waren sie nicht, und was sie nicht verstanden haben, konnten sie nicht aufhalten. Somit waren sie ,Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft‘.“
Die Strategie verfängt freilich nicht, erst recht nicht bei Lesern mit westlich-demokratischem Background. Dass es so mühselig ist, über den farbenfrohen Teppich zu gehen, liegt vor allem daran, dass Dotschanaschwili das, was er unter Freiheit versteht – und somit das eigentliche Thema seines Werks–, aus Zensurgründen im Dunklen lassen muss.
Die Botschaften, mit denen er zum Schluss aufwartet, bleiben abstrakt, um nicht zu sagen kitschig: Wer im Dreck, sprich unter Terror und Willkür lebt, hat die Möglichkeit, sich zu erheben; auch die größten Schurken sterben irgendwann einmal durch „fremde Hand“; der Einzelne zählt. Und vor allem: „Es ist die Liebe, die die Erde zum Drehen bringt.“