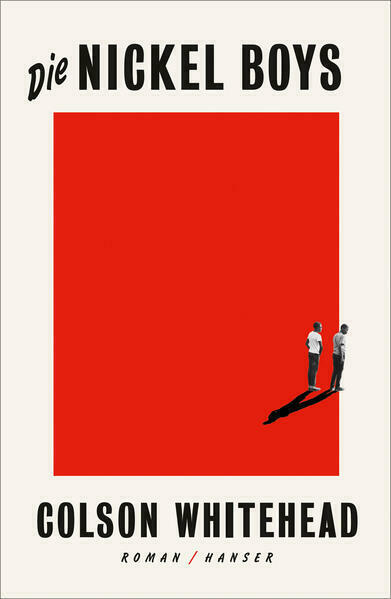Das Epizentrum des Horrors ist die Eiscreme-Fabrik
Klaus Nüchtern in FALTER 23/2019 vom 05.06.2019 (S. 35)
In seinem Roman „Die Nickel Boys“ widmet sich Colson Whitehead neuerlich dem Rassismus in der jüngeren US-Geschichte
Wenn schon im Prolog die Forensiker ihren Auftritt haben, verheißt das nichts Gutes. Die auf einem geheimen Anstaltsfriedhof exhumierten sterblichen Überreste junger Männer weisen eingeschlagene Schädel oder Schrotkugeln in den Brustkörben auf. Die Aufklärung dieser „Ungereimtheiten“ wird durch den Umstand erschwert, dass die Aufzeichnungen des „Nickel“, einer vor kurzem geschlossenen Besserungsanstalt für Knaben, ausgesprochen lückenhaft sind.
In der Exposition seines jüngsten Romans verknüpft Colson Whitehead Fakten mit der Fiktion: Verwiesen wird auf Recherchen, die sich in Wirklichkeit mit der Dozier School for Boys in Marianna, Florida befassten, und auf einen ehemaligen Insassen namens Elwood Curtis.
Wir begegnen dem Protagonisten von „The Nickel Boys“ zuerst zu Weihnachten 1962, als der Bub „das schönste Geschenk seines Lebens“ bekommt: eine Schallplatte mit Reden von Martin Luther King, die eine bessere Welt beschwören. „Nein“, wird sich der einst hingerissen Lauschende gegen Ende des Romans denken, „diesen Sprung zur Liebe konnte er nicht tun. Er verstand weder den Impuls zu diesem Aufruf, noch hatte er den Willen, ihn umzusetzen.“ Aber da ist Elwood buchstäblich schon ein ganz anderer. So gesehen kann man „Die Nickel Boys“ auch als brutal gescheiterten Bildungsroman lesen. Denn an sich ist der junge Elwood, der unter der Obhut seiner gestrengen Großmutter im schwarzen Viertel von Tallahassee aufwächst, genau aus jenem Holz geschnitzt, aus dem die Helden des Black American Dream gemacht sind: höflich, integer, lernbegierig und bereit, aus sich was zu machen.
Der erste böse Witz besteht schon einmal darin, dass von Fisher’s Universal-Lexikon, das Elwood bei einem Tellerwaschwettbewerb gewinnt, nur der Band „A-Bar“ das Vorgesehene auch enthält, während alle Folgebände aus unbedruckten Seiten bestehen. Aber nicht nur der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Arzt oder Rechtsanwalt bleibt Elwood verwehrt, er kommt auch noch völlig unschuldig just an jenem Tag ins Nickel, an dem er erstmals die High School betreten sollte, deren Besuch ihm von seinen Förderern ermöglicht wurde.
Von außen betrachtet sieht die „Besserungsanstalt“ eher nach Schule denn nach Gefängnis aus. Das Innere aber ist der pure Horror: ein rigides System, in dem man sich vom „Wurm“ zum „Ass“ hocharbeiten kann und im besten Falle vorzeitig entlassen wird, dessen Regeln aber von kafkaesker Undurchschaubarkeit bzw. von der Willkür sadistischer Wärter abhängig sind. Im Zentrum dieser Topografie des Grauens steht die sogenannte „Eiscreme-Fabrik“, in der ein gigantischer Ventilator die Schreie der Gefolterten übertönt und deren Blut an die Wände weht.
Nach dem pulitzerpreisgekrönten „Underground Railroad“ (2016) rollt Whitehead erneut einen von Gewalt bestimmten Strang schwarzer US-Geschichte auf, der freilich nicht chronologisch abgespult, sondern mit Rückblenden, Vorgriffen, Cliffhangern und historischen Exkursen recht sprunghaft dargeboten wird. Der unstete Wechsel zwischen personaler und auktorialer Erzählhaltung und der Umstand, dass die Leserinnen um einer dramatischen Pointe willen auf eine falsche Fährte gelockt werden, bremsen den Schwung der Story, die auf Surprise statt auf Suspense setzt, erheblich.
Auch sprachlich ist der Roman bzw. dessen Übersetzung nicht ohne Makel: die manirierten Vergleiche („Er schleppte die Worte wie Ambosse in den Taschen seiner Nickel-Kluft mit sich herum“) überzeugen so wenig wie die Kollision eines teils umgangssprachlich-saloppen („ausgebuffte Strippenzieher“, die irgendetwas „verklickern“), teils altbackenenen Idioms („Maulaffen feilhalten“, „sich sputen“ et cetera). Am Ende hat man viel Aufwühlendes erfahren; es stellt sich aber auch die Frage, ob der Stoff nicht besser in Form eines Sachbuches aufgearbeitet worden wäre.