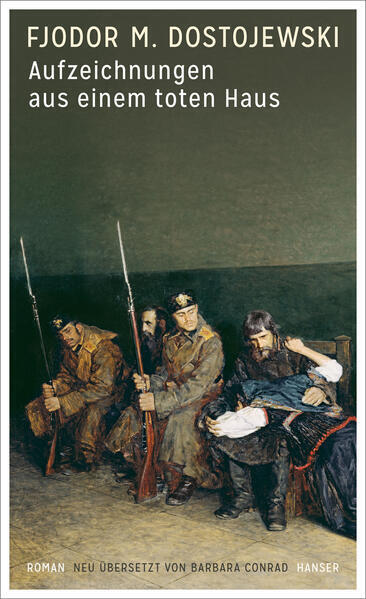Die sibirischen Jahre: Schläge, Schnee, Scharik
Klaus Nüchtern in FALTER 35/2020 vom 26.08.2020 (S. 32)
Nein, Fjodor Dostojewski hat seine Frau nicht umgebracht. Darin besteht der offenkundigste Unterschied zu Alexander Petrowitsch Gorjantschikow, dem (fiktiven) Verfasser der „Aufzeichnungen aus einem toten Haus“. Nachdem dieser seine zehnjährige Zuchthausstrafe abgesessen hat, fristet er „demütig und unhörbar“ sein Leben als Lehrer in einer sibirischen Kleinstadt. Vom (fiktiven) Herausgeber wird er als blasser, hagerer, äußerst schweigsamer und argwöhnischer Mann beschrieben, der, bald nachdem ihm dieser begegnet ist, verstirbt.
Tatsächlich war Dostojewski als Angehöriger des von zaristischen Spitzeln unterwanderten Zirkels um den Frühsozialisten M. W. Petraschewski zum Tode verurteilt, vor der Vollstreckung des Urteils in letzter Minute zur „Katorga“ (Verbannung plus Zwangsarbeit) „begnadigt“ worden. Die Sekunden vor der erwarteten Erschießung und die vier Jahre Gefangenschaft in Sibirien haben sein Menschenbild zutiefst geprägt, und die „Aufzeichnungen“ können als Präludium des ersten großen Romans aufgefasst werden, der 1866 unter dem Titel „Verbrechen und Strafe“ (in älteren Übersetzungen „Schuld und Sühne“) erschienen ist.
Aus der Sicht von Dostojewski/Gorjantschikow erweisen sich Zuchthaus und Zwangsarbeit als ein grausames Laboratorium, in dem die Grenzen zwischen Menschlichkeit und schierer Animalität ausgelotet werden. Den Tieren, die sich mitunter als „menschlicher“ erweisen, ist dabei ein eigenes Kapitel gewidmet: Es handelt nicht nur von der Konkurrenz zwischen zwei veterinär kompetenten Häftlingen, sondern auch von Gnedko, dem Pferd, Wasska, der Ziege und von Scharik, dem einzigen Wesen, „das mich liebte, an mir hing, mein Freund, mein einziger Freund“ – und der ein Hund ist.
Freundschaft unter den Häftlingen bleibt, wie Gorjantschikow, der Mörder aus Eifersucht, einmal feststellt, die absolute Ausnahme: Kameradschaft, ja; echte, persönliche Freundschaft, nein. Der Umgang unter den Häftlingen ist ruppig. Die anderen zu verhöhnen oder zu beschimpfen – „mit der Zunge prügeln“, wie’s im Zuchthaus-Argot heißt – ist „so etwas wie ein Vergnügen für alle“. Tatsächliche Schlägereien hingegen sind verboten und bleiben, der zu gewärtigenden Sanktionen wegen, die Ausnahme. Physisch geprügelt wird dennoch, aber hauptsächlich „von oben“ und nach exakten Vorgaben, denn Körperstrafen sind ein fixer Bestandteil im Rechtssystem des Russischen Reichs und werden mit dem Stock oder – besonders schmerzhaft – in Form des Spießrutenlaufs in exakt festgelegten Tranchen von bis zu 4000 Schlägen ausgefolgt.
Um das unerwünschte Ableben des Gezüchtigten zu verhindern, unterbricht ein anwesender Arzt die Prozedur – allerdings nicht immer rechtzeitig. Hat der Delinquent so viel Zeit im Hospital verbracht, dass sein Rücken einigermaßen verheilt ist, wird ihm das verbleibende Quantum an Prügel verabreicht. Es gibt Häftlinge, die die Tortur so bald wie möglich hinter sich zu bringen trachten, und jene, die vorsätzlich Aufseher attackieren, nur, um ein zusätzliches Verfahren und dadurch einen Aufschub ihrer Strafe zu erwirken, deren Ausmaß sich freilich zwingend erhöht (was den desperaten Delinquenten auch vollkommen bewusst ist).
Dostojewski ist ein präziser Beobachter, der an seinen Kameraden und nicht zuletzt an sich selbst illusionslos verzeichnet, was die Katorga aus den Menschen macht oder, umgekehrt, wie es um deren Ausstattung bestellt ist, sie zu ertragen. Der Wahrnehmungsmodus ist jener der teilnehmenden Beobachtung, die die kollektiven Verhaltensmuster ebenso verzeichnet wie die individuellen Abweichungen, die Kategorien etabliert und Typisierungen vornimmt, aber stets auch darauf beharrt, dass damit nicht alles und jeder erfasst ist.
Allein die drei „A“ unter den Insassen spannen das ganze Spektrum des Menschenmöglichen auf: Da ist A-w, der junge Adelige, der nach dem Motto „Wenn schon Zuchthäusler, dann aber richtig!“ alle Hemmungen fallen lässt und sich ganz „der unbezwingbaren Gier nach gröbsten, animalischsten körperlichen Genüssen“ überlassen hat; da ist Akim Akimytsch, ein Kauz von hohen Graden und zugleich ein handwerklich hochbegabtes Adaptionsgenie, der als einziger „die Kategorie der vollkommen gleichgültigen Zuchthäusler“ repräsentiert und sich im Gefängnis einrichtet, „als ob er vorhätte, sein ganzes Leben dort zu verbringen“; und da ist Alej, ein noch ganz junger, ebenso hübscher wie sanftmütiger Dagestaner Tatar, bei dem die Alphabeti- und Christianisierungsanstrengungen des Protagonisten gleichermaßen auf fruchtbaren Boden fallen, kurz und gut: eine Begegnung, an die sich dieser „als eine der schönsten in meinem Leben“ erinnert.
Dostojewskis Kartografie der Conditio humana beeindruckt durch drastische Schilderungen, besticht aber auch durch ihren unsystematischen Charakter. Der Verfasser beschreibt die zermürbenden Folgen der Haft, richtet sein Augenmerk aber auch auf scheinbar Nebensächliches: Eine mit großem Engagement und kindlichem Enthusiasmus bewerkstelligte und rezipierte Theateraufführung wird mit großer Liebe zum Detail besprochen, und selbst der Zwangsarbeit werden poetische Seiten abgerungen – etwa beim Schneeschaufeln: „Der lockere, gerade erst gefallene und oben leicht angefrorene Schnee ließ sich bequem in riesigen Klumpen mit der Schaufel aufnehmen und fortschleudern, noch in der Luft verwandelte er sich in glitzernden Staub.“