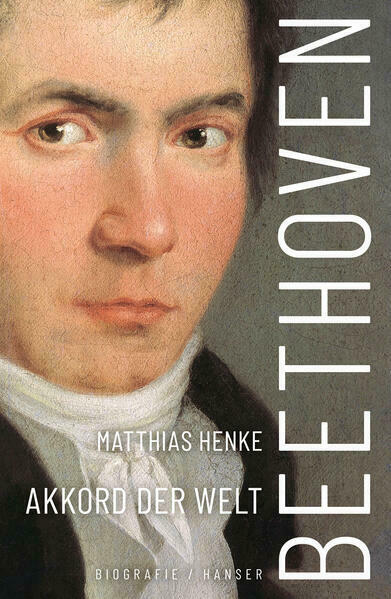Kein einsamer Revolutionär
Miriam Damev in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 40)
Musik: Zwei neue Bücher zum Jubiläum des Jahres, dem 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens (1770–1827)
Genie, Mythos, Titan, Revolutionär, empfindsam und cholerisch, exzentrisch und massentauglich, humorvoll und einsam – um keinen anderen Komponisten ranken sich so viele Mythen und Klischees wie um Ludwig van Beethoven. Das war schon zu seinen Lebzeiten so.
Anton Schindler, Beethovens Sekretär und erster Biograf, betrieb regelrechtes „Schindluder“ mit dem Erbe seines Auftraggebers. Als Beethoven am 26. März 1827 starb, hinterließ er rund 400 Konversationshefte, die ihm im Zuge seiner Ertaubung zur Verständigung gedient hatten. 136 Hefte blieben erhalten, die anderen vernichtete bzw. verfälschte Schindler. Und er fügte frei erfundene Gespräche mit Beethoven ein, um sich als dessen Intimus zu profilieren. Heute ist vieles über Beethovens Leben, seinen Alltag und seine Arbeit dokumentiert, die Frage „Was für ein Mensch war Beethoven?“ kann aber auch heute nur bedingt beantwortet werden. Also wird auch im Jubiläumsjahr munter publiziert, fabuliert, theoretisiert und ausgeschmückt.
Für ihr Buch „Der empfindsame Titan“ hat die Berliner Schriftstellerin, Sachbuchautorin und Musikwissenschaftlerin Christine Eichel vier Jahre lang in Archiven geforscht und Originaldokumente, Tagebücher und Konversationshefte ebenso wie Briefe und Rezensionen studiert, um die unbekannte Seite im Leben des Komponisten zu ergründen. Der tiefe Griff in die Klischeekiste lässt leider nicht lange auf sich warten: „Das Leben Ludwig van Beethovens gleicht mancher Rockstarexistenz heutiger Tage: schwierige Kindheit, rebellisches Künstlertum, provokantes Auftreten – dennoch reißen sich alle um ihn. Er ist das erste Enfant terrible der Musikgeschichte.“
Was als reißerischer Teaser noch zu verkraften wäre, zieht sich durch die gesamten knapp 400 Seiten, von Eichel in sechs Kapitel unterteilt und mit je einer bekannten Komposition Beethovens überschrieben. Dabei verliert sich die Autorin zwischen teils blumig-saloppen Beschreibungen des Umfelds Beethovens immer wieder in Plattitüden („natürlich sind außergewöhnliche Leistungen stets mit gewissen Kasteiungen erkauft“, „ein Kapellmeister bei Hofe rangiert auf derselben Hierarchieebene wie ein Küchenchef“) und hobbypsychologischen Mutmaßungen („auch vernachlässigte, ja sogar misshandelte Kinder stehen loyal zu ihren Eltern“).
Mit viel Schmelz und Pathos erzählt sie von Beethovens missglückten Liebschaften und liefert gleich die Erklärung dazu: „Bewusst oder unbewusst sucht er sich Frauen aus, die unerreichbar bleiben. Mit Blick auf die Couch könnte man ergänzen: so unerreichbar wie seine Mutter.“ Dazu werden dem Komponisten homoerotische Züge zugeschrieben – die Männerfreundschaften –, außerdem sei er schwer misogyn gewesen. „Eine derart ausgeprägte Frauenfeindlichkeit deutet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf unterdrückte homosexuelle Neigungen.“
Beethoven konnte seine beiden Schwägerinnen nicht ausstehen, andere Abneigungen gegen Frauen sind hingegen nicht belegt. In einem Interview mit dem NDR betonte Eichel, nichts hinzufantasiert zu haben. Tatsächlich gibt es unzählige Fußnoten am Ende des Buches, allerdings fehlt es der Autorin an kritischer Distanz und objektiver Professionalität. Positiv überrascht Eichel in jenen Kapiteln, die ausführlich auf das damalige Verlagswesen und Beethovens ziemlich ausgefuchsten Umgang damit eingehen – er korrespondierte mit über 40 Verlagen – oder die finanzielle und soziale Situation damaliger Künstlerexistenzen skizzieren. Interessant wäre auch gewesen, den vielen oberflächlichen Querverweisen weiter zu folgen, nicht nur zu Musikwissenschaftlern, sondern auch zu Komponistenkollegen, Dirigenten und Philosophen wie Hegel, Kant oder Schopenhauer.
Dass es auch ohne Pauschalisierungen und heroisierende Klischees geht, zeigt Matthias Henke in seiner Beethoven-Biografie „Akkord der Welt“. Henke, ebenfalls Musikwissenschaftler, schildert die Lebensgeschichte Beethovens weitgehend chronologisch und schafft einen facettenreichen, spannend zu lesenden Streifzug durch Beethovens bewegtes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, zwischen gefeiertem Genius und verwahrlostem Künstler, zwischen dem Schöpfer beispielloser Werke und von lebenslangen Leiden geplagtem Patienten, der mit zunehmender Taubheit immer mehr vereinsamte.
Henke gibt Beethovens Kurzzeit-Lehrer Joseph Haydn Raum, der ihn nicht nur kompositorisch beeinflusste, sondern ihm auch dabei half, in Wien Fuß zu fassen. Und in einem ausführlichen Kapitel relativiert er das gängige Bild des Komponisten als Revolutionär, der mit den Idealen der Französischen Revolution sympathisierte. Beethoven fühlte sich den Idealen des aufgeklärten Bürgertums nahe, war zugleich aber eng mit dem Adel verbunden und verstand es zudem vortrefflich, ihn für seine eigenen Zwecke einzuspannen.
Tatsächlich ging es Beethoven „nicht um einen Umsturz oder gar die Eliminierung einer Schicht, sondern um den humanen Gebrauch politischer Macht und die Idee der Freiheit“, schreibt Henke. Das zeige sich auch in der 1814 uraufgeführten, dritten Fassung seiner Oper „Fidelio“. „So fungiert der adelige Don Pizarro zwar als Schuft, als derjenige, der Florestan widerrechtlich eingekerkert hat. Aber sein Gegenspieler, der liberale Minister Don Fernando, ist gleichfalls von Stand.“ „Fidelio“ ist eine Freiheitsoper, allerdings nicht im Sinne der Französischen Revolution, die zum Ziel hatte, den Adel zu entmachten.
Beethoven ging es vielmehr um die Rechte des Individuums gegenüber den Repressalien der Obrigkeit, meint Henke. Er bewunderte Napoleon, um ihn später zu verachten. Henke sieht aber zwischen den beiden Männern durchaus Parallelen: „Man könnte Napoleon wie Beethoven Avantgardisten nennen, weil sie schneller und entschiedener in Neuland vorstießen, als die Menschheit auch nur ahnte.“ Jedenfalls hatte Beethoven bewiesen, dass er ebenfalls in der Lage war, die Massen zu bewegen. Der Uraufführung seiner „Schlachtensinfonie“ sollen 5000 Besucher beigewohnt haben. Der „einsame Revolutionär“ hatte sich zum Patrioten gewandelt, der das Bad in der Menge durchaus zu genießen wusste. Beim Wiener Kongress etwa erwies sich Beethoven als geschäftstüchtiger Star.
Er komponierte patriotische Kongresskompositionen, darunter das Chorlied „Germania“ oder die Kantate „Der glorreiche Augenblick“, fädelte Aufträge bei Adeligen und königlichen Oberhäuptern ein und ließ sich dafür gleich mehrfach fürstlich entlohnen. „Schade, dass ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst, ich würde ihn doch besiegen!“, behauptete Beethoven mit Bezug auf Napoleon. Und das gelang ihm auch: Nach dem großpolitischen Event in Wien wollte man selbst in den entlegensten Winkeln Europas seine Musik hören.
Nicht zuletzt lohnt sich Henkes Buch, weil er zum Schluss auch über den Tellerrand der Biografie schaut und in vier Extrakapiteln einen Exkurs in die Kulturgeschichte des Hörens unternimmt und sich der Nachwirkung Beethovens in Film und Werbung widmet. Hier kommt Mauricio Kagels „Ludwig van“ ebenso vor wie Horst Seemanns DEFA-Verfilmung „Beethoven. Tage aus einem Leben“, die 1976 in der DDR uraufgeführt wurde.
Der Arbeiter- und Bauernstaat stilisierte den Bonner Komponisten zum kulturellen Aushängeschild und vereinnahmte ihn für seine Kulturpolitik. Auch Seemanns Film entsprach der DDR-Ideologie. „Aber mit seiner besonderen Sicht auf Beethoven löste er sich zugleich von der Doktrin seines Staates.“ Im Mittelpunkt stand nicht mehr der Kult um das Genie, sondern der Künstler mit seinen persönlichen und künstlerischen Eigenarten. Zu guter Letzt wagt Henke sogar einen Abstecher in die Welt der Videospiele. Selbst hier findet sich Beethovens Musik als Soundtrack wieder.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: