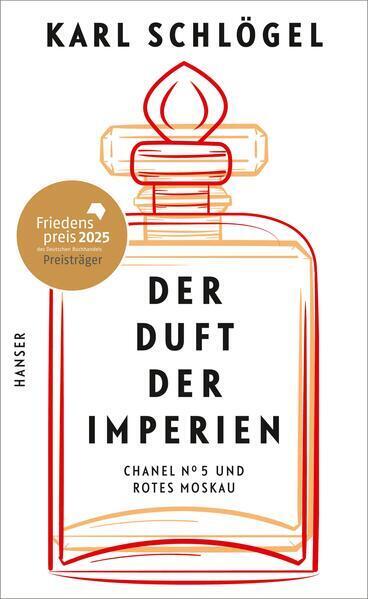Vom schwarzen Quadrat zum kleinen Schwarzen
Erich Klein in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 36)
Kulturgeschichte: Karl Schlögel rekapituliert den Siegeszug von Chanel Nº 5 und seinem Sowjet-Pendant Rotes Moskau
Im Sommer 1920 trifft Coco Chanel in Cannes auf einen gewissen Ernest Beaux, den Parfümeur eines Moskauer Unternehmens, das wenige Jahre zuvor anlässlich der Dreihundertjahrfeier der Romanows das Bouquet „Imperatrice Catherine II“ entwickelt hatte.
Auf seiner Flucht aus Revolution und Bürgerkrieg hatte er die Rezeptur eines Parfums nach Frankreich mitgebracht, das unter der Ägide von Gabrielle „Coco“ Chanel einen Siegeszug um die Welt antrat.
Chanel Nº 5 war geboren – das „Parfum für Frauen mit dem Duft der Frau“. Eine der zahlreichen Legenden über dessen Ursprung lautet, dass es an den Geruch des russischen Nordens erinnere, über den sein Erfinder geflohen war. Von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe stammte der spätere Werbeslogan: „Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel Nº 5.“ Als Kultgegenstand findet sich das edle Flacon heute im New Yorker Museum of Modern Art.
Dass es einen Zwilling des weltberühmtesten Duftes unter dem Namen „Rotes Moskau“ in der Sowjetunion gab, hat nicht erst Karl Schlögel entdeckt. Aber der renommierte Osteuropahistoriker, von dem zuletzt das monumentale Werk „Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt“ (2017) erschien, erzählt die Entwicklung des Luxusartikels in altbewährter Manier als eminent politische west-östliche Geschichte.
Wie üblich erfolgt das mit großer Geste: „Beide Parfums stehen für die Entstehung neuer Duftwelten, für radikal unterschiedlich verlaufende Biografien, für kulturelle Milieus im Paris und Moskau der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“ Das Zeitalter der Extreme habe rabiate Ideologien hervorgebracht, die weit in die Geruchslandschaften des Alltages hineinreichten: „Revolutionen, Krieg, Bürgerkriege sind auch olfaktorische Ereignisse. Die Teilung der Welt im vergangenen Jahrhundert kann jetzt post festum und zusammenhängend – gleichsam mit der Nase – erkundet werden.“
Die Geschichte der chemischen Zubereitung der beiden Parfums wird rekapituliert, die sich im Lauf der Zeit immer weiter voneinander entfernen. In der Sowjetunion mutiert der einstige Hof-Parfumeur zum „Staatlichen Seifensiederei-Betrieb Nr. 5“, später wird er in „Neue Morgenröte“ umbenannt. Schlögel sucht in immer neuen Anläufen nach Vergleichen und Zusammenhängen, um seiner nicht nur metaphorisch gemeinten These vom „Duft der Imperien“ Plausibilität zu verleihen: „Im Tropfen eines Parfums kann die Geschichte des 20. Jahrhunderts sein“, heißt es einmal; dann wird über die Vorherrschaft des Gesichtssinnes über den Geruchssinn räsoniert oder theoretische Zuflucht bei Marcel Proust gesucht.
Wie schon in früheren Büchern referiert Schlögel noch einmal die Geschichte von Russlands stürmisch nachgeholter Modernisierung an der Wende zum 20. Jahrhundert, äußert verknappt und konzentriert auf die Geschichte von Apothekern, Hygieneartikelherstellern, deren Unternehmergeist Russland am Vorabend des Ersten Weltkrieges zum weltweit größten Parfumproduzenten machte. Mit der bolschewistischen Oktoberrevolution trifft am Petersburger Newski-Prospekt scharfer Machorka-Tabakgeruch auf die Welt der parfümierten Fräuleins. Duftwellen höchst unterschiedlicher Art liegen nach dem Sieg des Proletariats miteinander im Streit.
Es ist eine bemerkenswerte Parallelaktion, die jetzt international abläuft. Während Coco Chanel das berühmte „kleinen Schwarze“ entwirft, wird im Land der Sowjets nach anfänglich avantgardistischen Modeexperimenten mittlerweile „zweckmäßige Kleidung für die moderne Frau im Sozialismus“ propagiert. Verantwortlich dafür ist eine gewisse Nadeschda Lamanowa, in Hinkunft die führende sowjetische Modedesignerin.
Auch Parfums, so Schlögel, können sich nicht aus dem Gewalt- und Verführungszusammenhang der heraufziehenden Totalitarismen heraushalten. Nicht ganz geschmackssicher begibt sich der Historiker in die Geruchswelten von Konzentrationslagern und sowjetischem Gulag, umso interessanter fällt die Geschichte von Coco Chanels Nazi-Kollaboration und jene von Polina Schemtschuschina aus, der Ehefrau von Außenminister Molotow, die den Erfolg des Sowjetparfums „Rotes Moskau“ verantwortete.
Am Ende von „Der Duft der Imperien“ steht eine skurrile Entdeckung: Der Flacon-Designer des ursprünglich russischen Parfums Chanel Nº 5 war kein Geringerer als der Maler des „Schwarzen Quadrates“, der Avantgardist Kasimir Malewitsch, der damit eine der Ikonen der Malerei des 20. Jahrhunderts geschaffen hatte.