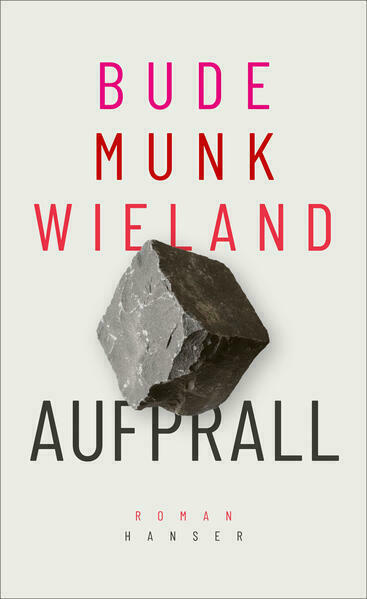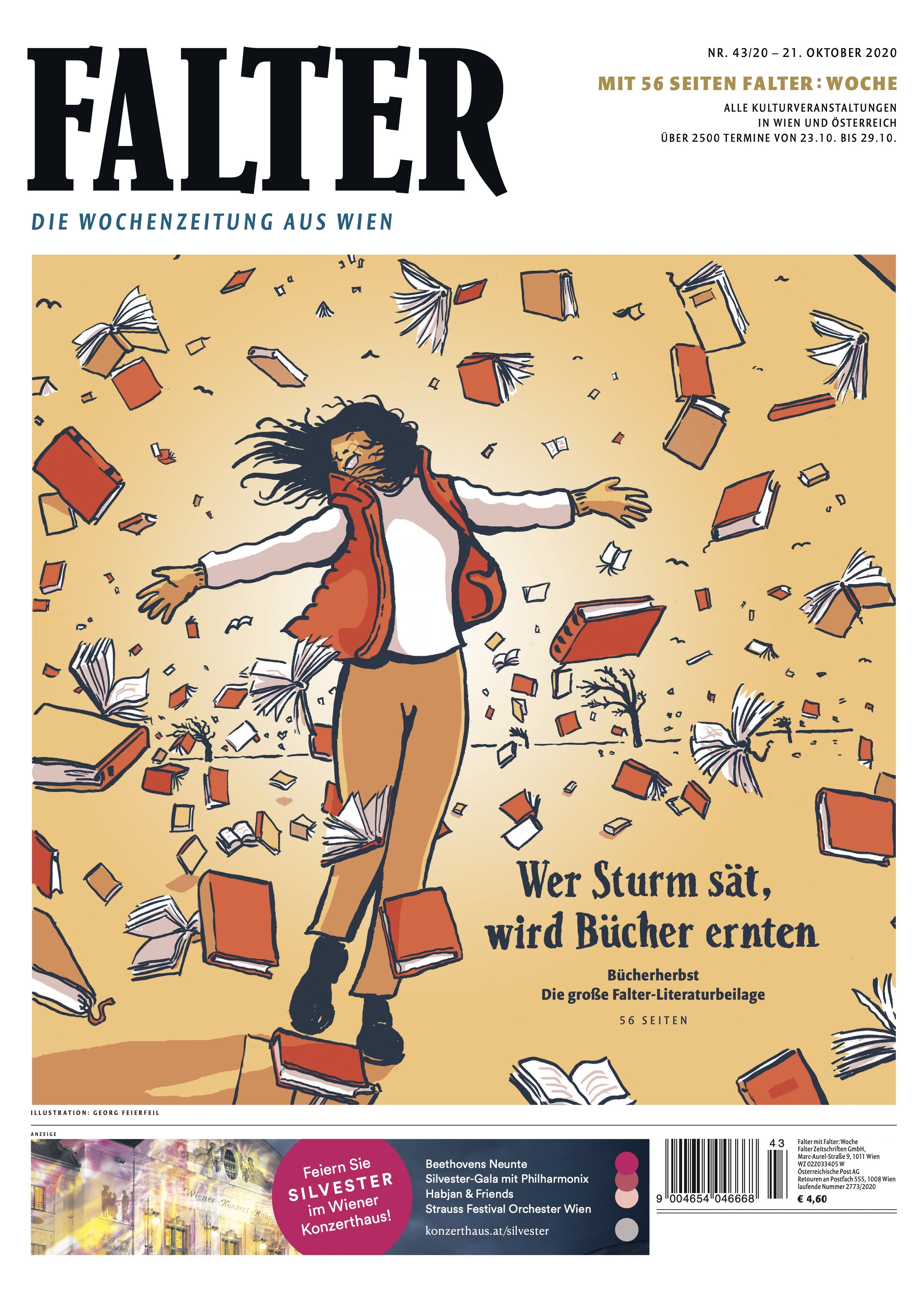
Zwischen Chaostagen und Mervenächten
Thomas Edlinger in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 25)
Das Westberlin der frühen 1980er-Jahre war ein „Museum der Behauptungen“, heißt es einmal in diesem ungewöhnlichen Generationenroman über eine schon reichlich beackerte Zeitspanne in der Mauerstadt. Szenekneipen nannten sich „GOTT“, angesagte Bands sollten „Zwischenchefs“ heißen, Antikunstorte hießen „Laden für Nichts“ und Kreuzberg brannte verlässlich am 1. Mai, wenn wieder einmal die anarchische Losung einer befreiten Zone zwischen der Faschohippiesspießer-BRD und der exotisch fernen DDR ausgegeben wurde.
Die Einstürzenden Neubauten zerdepperten derweil viel Metall unter Autobahnbrücken, während ein bunter Haufen transformationssüchtiger junger Menschen in besetzten Häusern Fallen gegen Nazi-Überfälle bastelte und im Fronteinsatz gegen den Bullenstaat Tag und Nacht den Polizeifunk abhörte. Bürgerkinder hielten sich für Kommunisten und kamen aus Schulen, in denen man für Kritik an der Gesellschaft gute Noten bekam. Proletarier erlagen dem esoterischen Charme einer Philosophie am Abgrund. Junge Künstlerinnen holten sich bei Gilles Deleuze den Tipp ab, zum Ei zu werden. Dann wäre man endlich ohne Sinn und Ziel, aber immer in Bewegung.
Dieses umstürzlerische Milieu schildert „Aufprall“ aus der Innensicht: Bude/Munk/Wieland sind alle um die 60 Jahre alt. Sie haben mit diesem Buch ihren jeweils ersten Roman verfasst, und das gleich als Kollektiv. Die Mischung und die Idee haben es in sich. Der Soziologe und Generationenspezialist Heinz Bude ist frischgebackener Gründungsdirektor des documenta-Instituts in Kassel und weist gern darauf hin, dass man nicht in keiner Stimmung sein kann. Bettina Munk ist eine Künstlerin, die nach Aufenthalten in New York und London nun wieder in Berlin lebt und in das Wort Koinzidenzen verliebt ist. Karin Wieland schließlich schrieb Sachbücher über Bert Brecht, Marlene Dietrich oder Leni Riefenstahl und ist zudem mit Heinz Bude verheiratet.
Der Roman erzählt aus drei wechselnden Perspektiven über junge Unverstandene oder mit allem Nicht-Einverstandene, die sich im Provisorium besetzter Häuser fanden und teilweise auch wieder verloren. Zu einer männlichen und einer weiblichen gesellt sich einer chorisch-weibliche „Wir“-Sichtweise, die den antiindividualistischen Impuls des Romanpersonals in entsprechende Worte kleidet. Immer wieder geht es um „uns“ und die teils sektiererischen Aufspaltungen des „Wir“, aber selten um das heute so vielbeschworene Ich.
Der Titel des Romans verweist auf einen tragischen Autounfall in der damaligen Tschechoslowakei im Jahr 1982. Der alte Mercedes einer Hausbesetzer-Viererbande kracht in einen sowjetischen Militärlaster. Die Theaterstudentin Soraya ist sofort tot, die in Turin aufgegabelte Elena und eine der beiden erzählenden Hauptfiguren, der Philosophiestudent Thomas, sind nur leicht verletzt. Die zweite Erzählfigur, die Künstlerin Luise, überlebt den Crash nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt.
Der Unfall wirft aber niemanden aus der Bahn, weil es gar keine Bahn gibt, aus der diese jungen Leute geworfen werden könnten. Berlin ist noch lange keine durchgentrifizierte Partystadt, aber auch keine gemütliche Kiezgegend mehr, sondern erscheint als eine graue, kalte und harte Stadt voller Möglichkeiten, in denen die Holzbretter aus den Treppenhäusern verfeuert werden und der Hedonismus noch in den Kinderschuhen steckt.
Das Buch erzählt ohne Sentimentalität, mit dem richtigen Maß an Szenejargon und mit nicht zu viel Pathos davon, dass es Zeiten gab, in denen Teile einer vom Kreuzberger Mikroklima beeinflussten Generation alles infrage stellten und viel aufs Spiel setzten. Statt Familien zu gründen, zelebrierte man den aus dem wilden, französischen Denken importierten „Kult des Verrücktseins“. Genährt wurde der Kampf um das Anderssein und dabei Rechthaben mit radikalen Experimenten wie der weitgehenden Zurückweisung von Privatheit und der Dauerkonfrontation mit ideologischen Verbohrtheiten. Dabei tauchen schon auch mal „die toten Augen des Zonenrandgebiets“ oder „Prollkids“ auf, ohne dass man nun sicher wüsste, ob das Figurenrede oder Soziologenprosa ist.
Über weite Strecken entfaltet der Roman – trotz diverser zeithistorischer und in der Regel durchaus erhellender Reflexionen über geistige und subkulturelle Positionen – eine erstaunliche Anschaulichkeit. Der Philosoph Philipp Felsch, Jahrgang 1972, beschrieb 2015 in seinem Buch „Der lange Sommer der Theorie“ aus der Perspektive des Spätgeborenen eben diese nicht nur als einen Wahrheitsanspruch, sondern auch als einen Glaubensartikel und als einen Lebensstil. Mit dem Merve-Bändchen über das intensive Leben in der Lederjacke konnte man sich eine Zeitlang als genialer Dilettant fühlen, der gefährliche Denker liest und gefährlich lebt. „Aufprall“ zeigt, dass es ein solches Leben zwischen Chaostagen und Mervenächten tatsächlich gab.
Es brauchte aber, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den aufmerksamkeitssüchtigen Social-Media-Aktivitäten von heute, keine Dritten, der dem Experiment im real existierenden Leben Applaus spendete. Man machte einfach. Und am Ende dieses Wegs der Deleuze’schen Eier ohne Sinn und Ziel machten sich manche wie Vroni, eine Arbeitertochter aus Wien, einfach kaputt. Sie stirbt, nachdem sie im „Türkenpuff“ anschaffen ging, an einer damals neuen Krankheit namens Aids. Knapp vor ihrem Tod wünscht sie sich Heurigenlieder von denen, die für sie da waren oder einfach da waren. Für immer Punk eben.