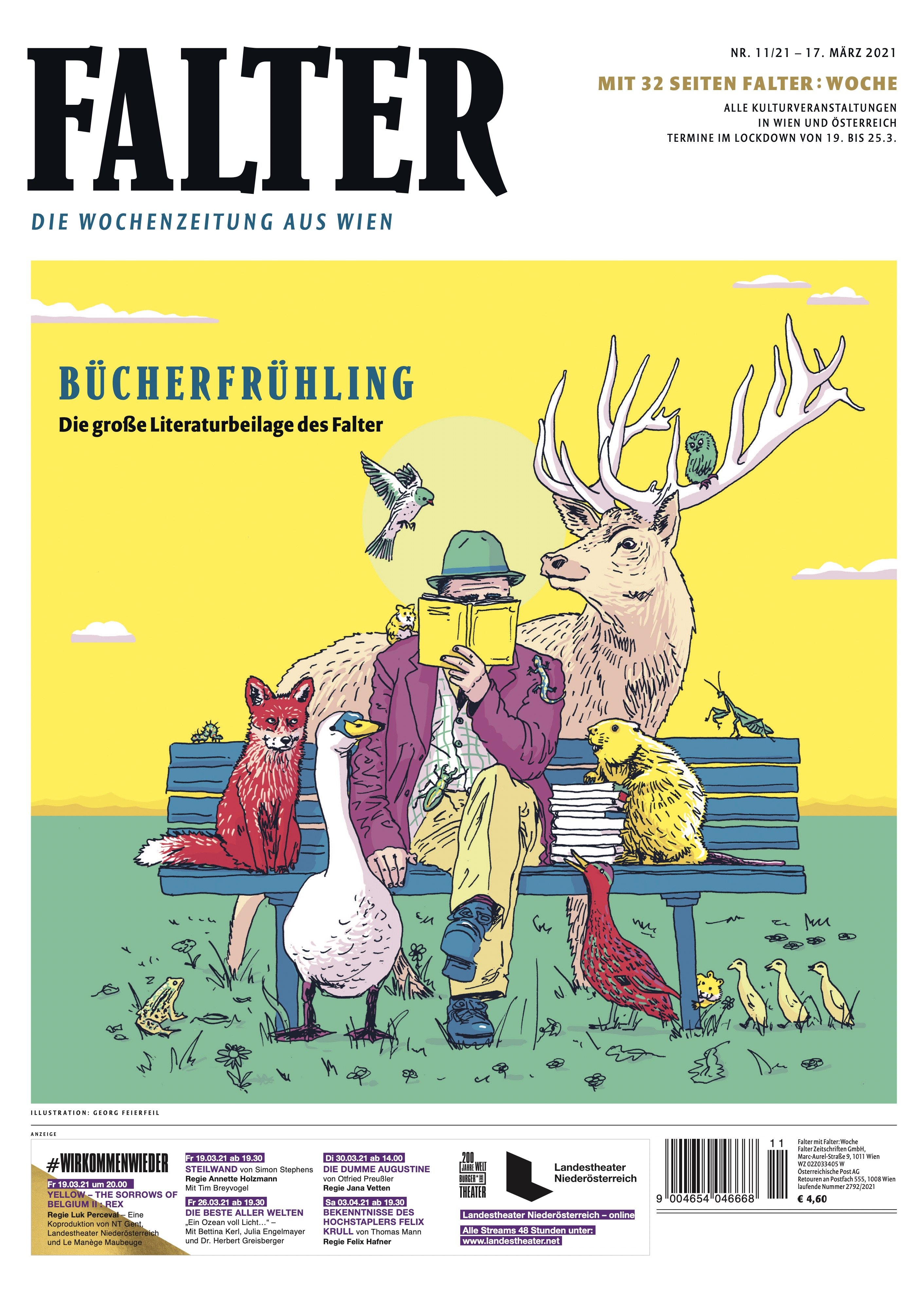
Hier geht es um die Hand und nicht um den Fuß
Stefanie Panzenböck in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 33)
Der Fußball ist schuld. Nämlich daran, dass der Hand nicht die Bedeutung zukommt, die ihr gebührt. Denn dort gilt die Hand „schlechthin als tabuisiertes Organ, sie steht unter Berührungsverbot“, schreibt der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch in seinem Buch „Hände“. Er diagnostiziert eine „Epoche des umfassenden Körperkults“, in der „das komplexeste menschliche Organ eine irritierende Vernachlässigung“ erfahre, und nennt etwa auch das Handwerk, das sein Ansehen mehr und mehr verlöre.
Knapp 140 Seiten später kommt Hörisch noch einmal auf den Fußball zurück und beschreibt das irreguläre Handspiel des Fußballstars Diego Maradona, mit dessen Hilfe er bei der Weltmeisterschaft 1986 ein Tor erzielte, das anerkannt wurde. Es sei „ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes“ gewesen, rechtfertigte sich der Spieler. Abgesehen davon hält sich Hörisch im Verlauf seines Textes kaum mit den Niederungen der Populärkultur auf. Im Zentrum seiner Kulturgeschichte steht die hohe Literatur.
Hörisch durchforstet die Werke Goethes, wie etwa „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“, nach Szenen, in denen Hände eine Rolle spielen, oder widmet sich „Werthers Verehrung von Lottes Händen“. Der Werther erscheint an dieser Stelle bereits zum zweiten Mal, denn schon in der ausführlichen Einleitung geht Hörisch auf Goethe und die Hände ein.
„Hände sind die Organe, die es wirklich gibt, und die schaffen (aber auch abschaffen) können, was es zuvor nicht gab (beziehungsweise alsbald nicht mehr geben wird)“, schreibt Hörisch. „Hände sind die produktiven (und destruktiven) Organe schlechthin.“ Und weiter: „Berühmt wurde Goethe in jungen Jahren mit einem Roman, dessen Ende ergreifend lakonisch davon berichtet, wie ein junger Mann Hand an sich legt, weil er keine Aussicht darauf hat, erfolgreich um die Hand einer geliebten Frau zu bitten.“
Goethe spielt in Hörischs Kulturgeschichte eine zentrale Rolle. Doch auch andere Werke der Literaturgeschichte werden ausführlich auf die Rolle, die Hände in ihnen spielen, untersucht“. Etwa Thomas Manns „Buddenbrooks“. Hier nennt Hörisch sogar eine Zahl: Das Wort „Hand“ bzw. „Hände“ werde auf 837 Seiten der Kritischen Edition 642 Mal verwendet. Auch Martin Heideggers „Zuhandenheit“ und „Vorhandenheit“ kommen zur Sprache sowie eine große Anzahl anderer großer Geister wie Herder und Kant, Schnitzler, Rilke, Heine und Kafka.
Die Hand Gottes wird ebenso abgehandelt wie die „unsichtbare Hand des Marktes“, die Hörisch als Erbin der Ersteren begreift. Schließlich geht es um die Rivalität zwischen privater und öffentlicher Hand. Auch die Raute, die die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Händen des Öfteren bildet, findet Erwähnung. Hörisch stellt hohe Ansprüche an seine Leserinnen und Leser, führt sie elegant, manchmal auch sprunghaft von einem Werk der Weltliteratur zum nächsten. Etwas mehr Einblicke in die bildende Kunst oder gar in die Musik wären erfreulich gewesen.




