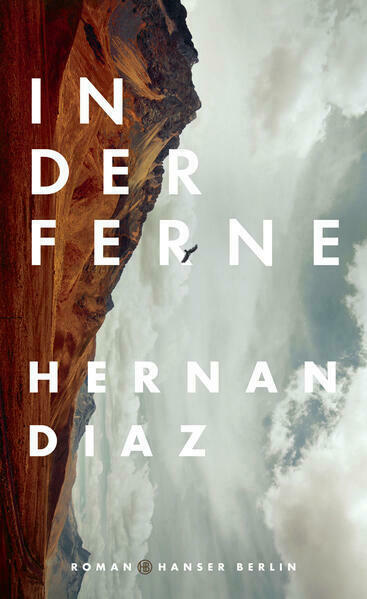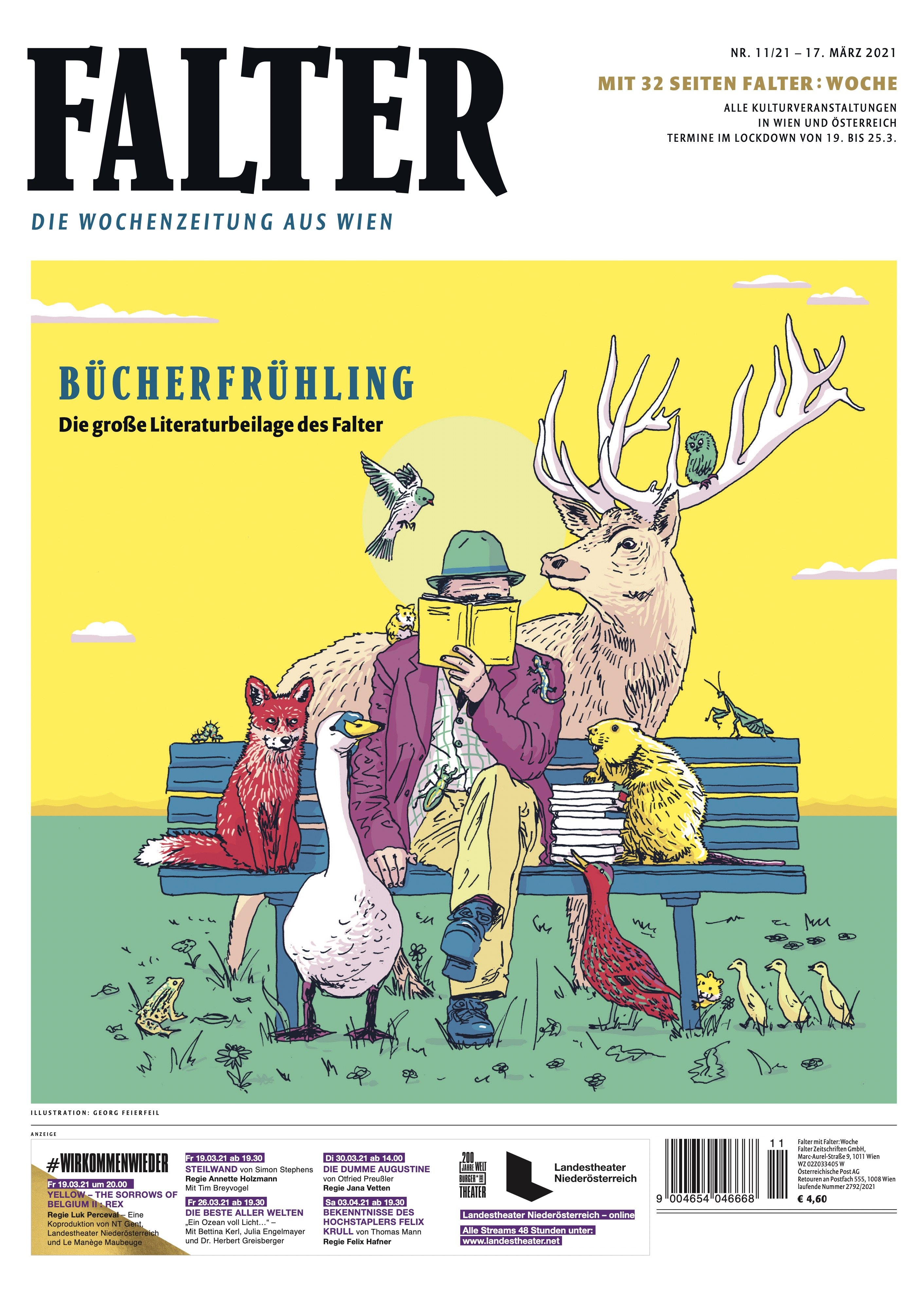
Ungute Menschen in feindseliger Landschaft
Tiz Schaffer in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 24)
Der Western ist nicht mehr das, was er einmal war. Vierschrötige Männer mit der Hand stets am Abzug, im Hinterhalt lauernde Native Americans – das geht sich in Zeiten von Identitäts- und Diversitätspolitik nicht mehr aus. Wer sich literarisch an die amerikanische Pionierzeit des 19. Jahrhunderts heranwagt, kommt zwar um die säckeweise abgestellten Stereotypen nicht ganz herum, sollte aber – um nicht ganz aus der Zeit zu fallen – von ihrer Romantisierung tunlichst absehen, sie schon gar nicht in alter Manier zusammenschrauben. Neue Perspektivierungen, neue Sujets, neue Helden und Heldinnen braucht der Westernroman!
Die US-amerikanische Schriftstellerin Téa Obreht etwa brachte in ihrem von der Kritik gefeierten Buch „Herzland“ neben einem Einwanderer aus dem Osmanischen Reich eine toughe Siedlerin als zentrale Protagonistin in Stellung. Und im Erstlingsroman von Hernan Diaz, der soeben unter dem Titel „In der Ferne“ in deutscher Übersetzung erschienen ist und der 2018 für den Pulitzerpreis nominiert wurde, steht ein schwedischer Emigrant im Mittelpunkt.
Obreht und Diaz verbindet zum einen, dass sie den klassischen Western auftrennen und neu stricken, zum anderen, dass sie beide auf eine persönliche Migrationsgeschichte zurückblicken: Obreht wurde in Belgrad geboren, der heute in New York lebende Diaz kam 1973 in Argentinien zur Welt, aufgewachsen ist er in Schweden, wohin seine Familie vor der Militärdiktatur geflohen war.
Diaz dockt nun an seine Biografie an: Wichtigster Protagonist von „In der Ferne“ ist ein junger Bursche, Håkan Söderström, der gemeinsam mit seinem älteren Bruder Mitte des 19. Jahrhunderts von Schweden nach New York aufbricht, um dort ein besseres Leben zu finden.
Gleich zu Beginn der Reise verlieren sich die beiden Brüder, und Håkan landet nicht in New York, sondern auf der anderen Seite des Kontinents in San Francisco, wo seine eigentliche Odyssee beginnt: Mittellos, minderjährig, zu Fuß und der englischen Sprache nicht mächtig, macht er sich Richtung Osten gegen den Siedlerstrom nach New York auf, um seinen Bruder zu finden. Letztlich wird er jahrelang durchs Land irren, sein Haar wird ergrauen und er noch immer nicht angekommen sein.
Was das Buch besonders macht, ist nicht nur, wie anstandslos Elemente von Abenteuer- und Bildungsroman, Reiseerzählung und Nature Writing zu einem Neo-Western fusioniert werden, es ist vor allem die personale Erzählperspektive: Durch einen impressionistischen Filter seiht Diaz für den Leser nur das ab, was Håkan sehen, hören, fühlen und begreifen kann.
Und gerade Letzteres gelingt dem Schweden oft so gar nicht, mangelt es diesem doch an Sprachkenntnis sowie Lebenserfahrung. Sobald er auf seiner Wanderschaft auf andere Menschen trifft – etwa einen halbverrückten irischen Goldsucher oder eine zahnlose Salonbesitzerin, die sich Håkan als Sexsklaven hält –, dünkt
ihn deren Verhalten zunächst meist rätselhaft. Er braucht, zurückhaltend, wie er ist, seine Zeit, um hinter die Fassaden zu blicken, wo zumeist nur Arglist lauert. Zuneigung erfährt er kaum. An und mit den widrigen Bedingungen wächst aber auch Håkan. Er wird zu einem schier unbezwingbaren Hünen und entwickelt nicht zuletzt moralische Größe.
Dennoch oder vielleicht gerade deshalb findet er keinen Platz in einem Land, das ihm, wie dessen Bewohner, feindselig gegenübersteht. Ob in der Prärie, der Wüste, auf Bergen oder in einem Canyon – Håkan befindet sich in einem ständigen Überlebenskampf. Beinahe klaglos erträgt er Schmerz, Hunger und Durst, ebenso die mitunter halluzinatorischen Begleiterscheinungen von Einsamkeit und Isolation.
Während der jahrelangen Arbeit an „In der Ferne“ hat Hernan Diaz, der auch Literaturwissenschaftler ist, etliche Romane des 19. Jahrhunderts gelesen, sich darüber hinaus in Reiseliteratur, medizinische Handbücher oder die Schriften von Naturforschern dieser Zeit vertieft.
Mithin sind es nicht bloß die fein säuberlich aneinandergereihten Abenteuer und ihre überraschenden Wendungen, die den Roman so packend machen, sondern das satte Wissen über die Techniken des (Über-)Lebens fernab jeder Zivilisation und in einer Landschaft, die nur das herzugeben bereit ist, was ihr mühsam entrissen wird. Nahrung suchen, Fallen stellen, Tiere häuten, Kleidung fabrizieren, Medizin herstellen, Wunden versorgen, Lager errichten – das liest sich hier ungelogen so spannend wie ein Duell zu High Noon.