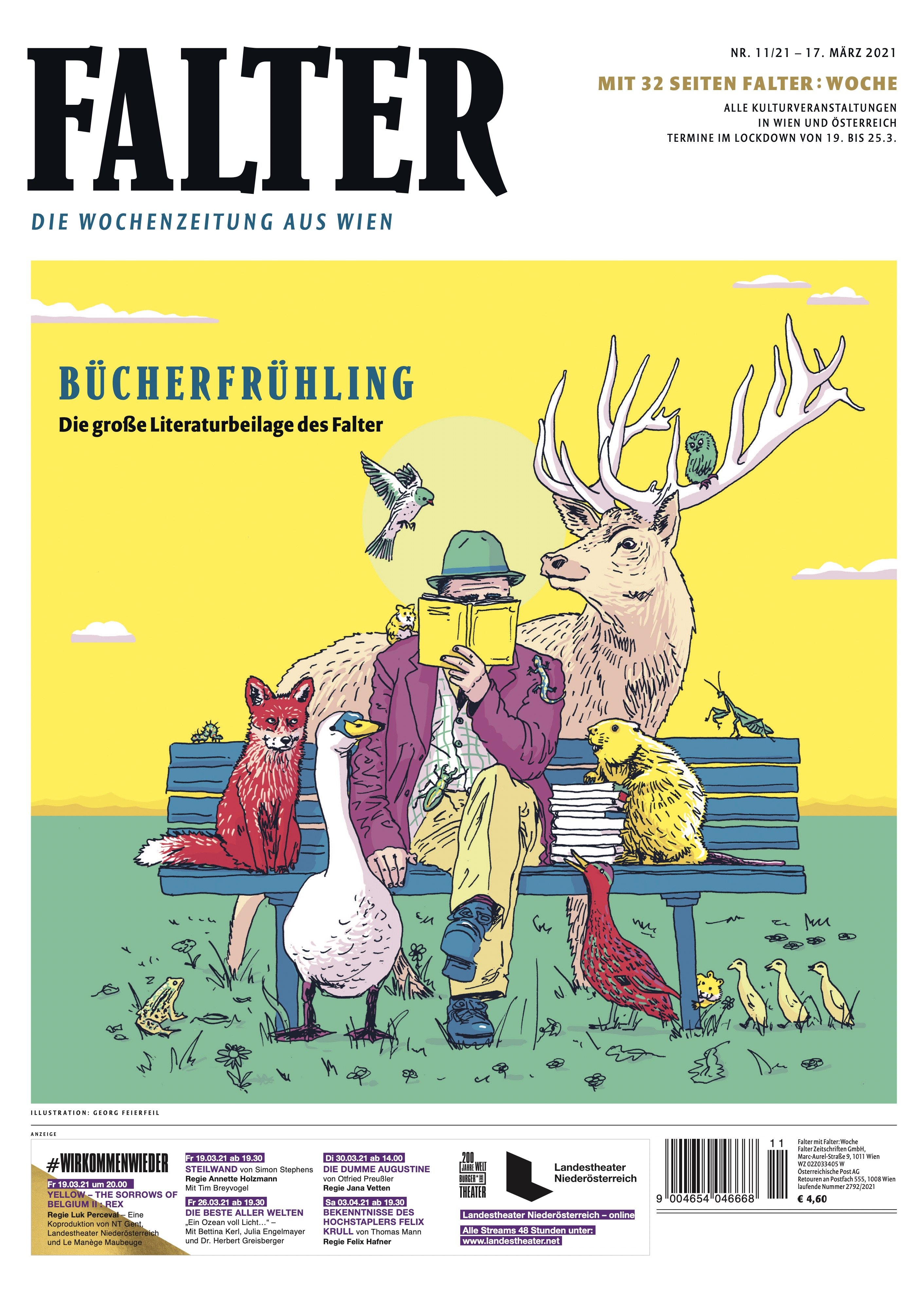
Wollt ihr die totale Fantasie?
Thomas Edlinger in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 25)
Charlie Kaufman gilt als genialisch versponnener Kopf, der als Drehbuchautor und Regisseur mit Lust und Witz Konventionen durcheinanderwirbelt und dramaturgische Standards wie Plotpoints verweigert. Seine Werke stecken voller vertrackter Zeitenfolgen und verschachtelter Erzählstränge. Häufig bespiegeln sie in narzisstischer Ironie die Schaffen- und Identitätskrisen des eigenen Ichs bzw. das Filmemachen – inklusive der eigenen Starpersona, die etwa in „Adaption – Der Orchideendieb“ gleich doppelt als Zwillingsbruderpaar Donald und Charlie Kaufman in Szene gesetzt wird, dessen eine Hälfte Charlie das Drehbuch zum Film „Being John Malkovich“ von Spike Jonze geschrieben hat. Kaufman tüftelt gern an metareflexiven Fragen herum: Welcher Film lässt sich als Film im Film erzählen, und ginge da nicht noch mehr, zum Beispiel ein Film im Film im Film, der rückwärts erzählt wird?
Nun legt der 62-Jährige mit dem Faible für Puppen und das Puppenhafte vermeintlicher Individualisten sein spätes Romandebüt vor. „Ameisig“ führt die Obsessionen des Cineasten und Filmkritikkritikers fort, steigert aber den Grad der Vertracktheit noch einmal ganz gewaltig. Das Buch erzählt in der Ich-Perspektive vom Leben des Filmkritikers B. Rosenberg, dessen unzählige und selbstverständlich unzureichend gewürdigte Veröffentlichungen vom unbestechlichen Blick einer überragenden filmischen Intelligenz mit enzyklopädischem Wissen und Hang zu avantgardistischer Sprödheit künden.
Rosenberg bringt durch den Vornamen B. die Ablehnung binärer Genderkonstruktionen zum Ausdruck, erzählt voller Stolz von seiner schönen afroamerikanischen Freundin und versichert jedem und jeder, kein Jude zu sein, auch wenn ihn viele für einen halten. Mit seinen oft vernichtenden Urteilen über die Zwänge Hollywoods und die Routinen des Arthouse-Kinos hält der Erzähler nicht hinter dem Berg – besonders ein gewisser Charlie Kaufman kriegt regelmäßig sein Fett ab.
Je länger der Mittfünfziger Rosenberg aber von sich erzählt, desto inkonsistenter erscheint seine Haltung zur Welt, besonders zu den derzeitigen Ausprägungen der Identitätspolitik in den USA. Macht sich das nonbinäre B. am Ende über antirassistische Achtsamkeitsgebote und den Rigorismus der von alten, weißen Männern geforderten Ich-Abspeckung lustig?
Vom Verlag als „unendlicher Spaß“ mit offensichtlichem Bezug auf den gleichnamigen Roman von David Foster Wallace beworben, geht es auch hier um die Suche nach einem Film, genauer, um die Rekonstruktion einer in Flammen aufgegangenen, singulären Filmkopie. Diese ist das Lebenswerk des im hohen Alter verstorbenen und zuvor mit dem Erzähler bekannt gewordenen, afroamerikanischen Regisseurs Ingo Cutbith.
Man ahnt schon, dass nach diesem noch halbwegs plausiblen Plot vieles „kontraintuitiv“ weitergehen wird (so formuliert der Ich-Erzähler die Ausgangslage des TV-Horrorfilms „Schrei mich in den Schlaf“, in dem die Schreie eines Monsters Menschen in den Schlaf wiegen, in dem sie dann umgebracht werden).
Cutbiths unsichtbarer Film aber, von Rosenberg instinktiv als unübertreffbares Meisterwerk erkannt, hat eine Spielzeit von drei Monaten und wird sich, neu konfiguriert im Kopf des von seiner Reanimation besessenen Kritikers, möglicherweise als technologisch aufgerüsteter Knetanimationsfilm über ein krisengeschütteltes Comedy-Duo entpuppen. Oder als langes weißes Nichts, das am Ende nicht mehr nichts ist, sondern ein zutiefst persönlicher Dialog mit dem Filmemacher, der sich über Stunden vom winzigen Punkt zum Körperbild aufbaut. Oder der Film endet in einer Million Jahren mit der Herrschaft einer hyperintelligenten, einsamen Ameise namens Calcium. Oder geht es letztlich um die Würdigung der Ungesehenen im Film?
Über all das lassen sich kaum verlässliche Aussagen treffen, denn das einzige Hilfsmittel der Recherche über den Film ist das Gedächtnis von Rosenberg, dem mit Hilfe von Hypnosetechniken auf die Sprünge geholfen werden soll. Durch diese Art von erzählerischem Trick (die anderenorts im Roman als billige Legitimation für Charlie Kaufmans Zwangsoriginalität kritisiert wird) entbindet sich der reale Autor Kaufman von jeglicher Forderung nach Stringenz. Nichts erscheint unmöglich in diesem Zwischenreich zwischen Fiktion und Metafiktion. Aber weil in diesem Pluriversum fast alles zwischen popkultureller Referenz, Kulturwissenschaftsparodie und Problematisierung eines neurosengeplagten Egos mit Clown-Fetisch Platz hat, ermattet auch das Interesse am Versuch, den Narrationsebenen zu folgen und die Wirklichkeitsbezüge zu entwirren.
Nichtsdestotrotz blitzen immer wieder hochkomische Passagen auf, zum Beispiel jene über das Los des Intellektualismus in einer Welt voller schlecht durchdachter Filme über Zeitschleifen. Ein Rumpelstilzchen namens Donald Trunk beziehungsweise seine robotische Doppelgängerarmada kommen auch vor und plappern – ausgerechnet inmitten dieses am Ende doch ziemlich überreizten Ideenfeuerwerks ohne schnöden Wahrheitsanspruch – etwas von Fake News. Später hat auch noch das berühmte, über mehrere Zeilen zitierte Zitat Walter Benjamins über den Engel der Geschichte seinen Auftritt, der vom Fortschritt in die Zukunft geweht wird. Was es illustrieren soll, bleibt unklar. So wie der Ich-Erzähler immer wieder in Slapstick-Manier in offene Kanalschächte plumpst, gerät auch der Leser angesichts dieses fiktionalen Blendwerks gehörig ins Stolpern.




