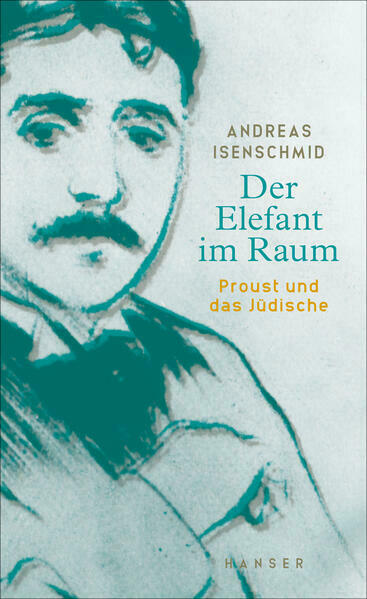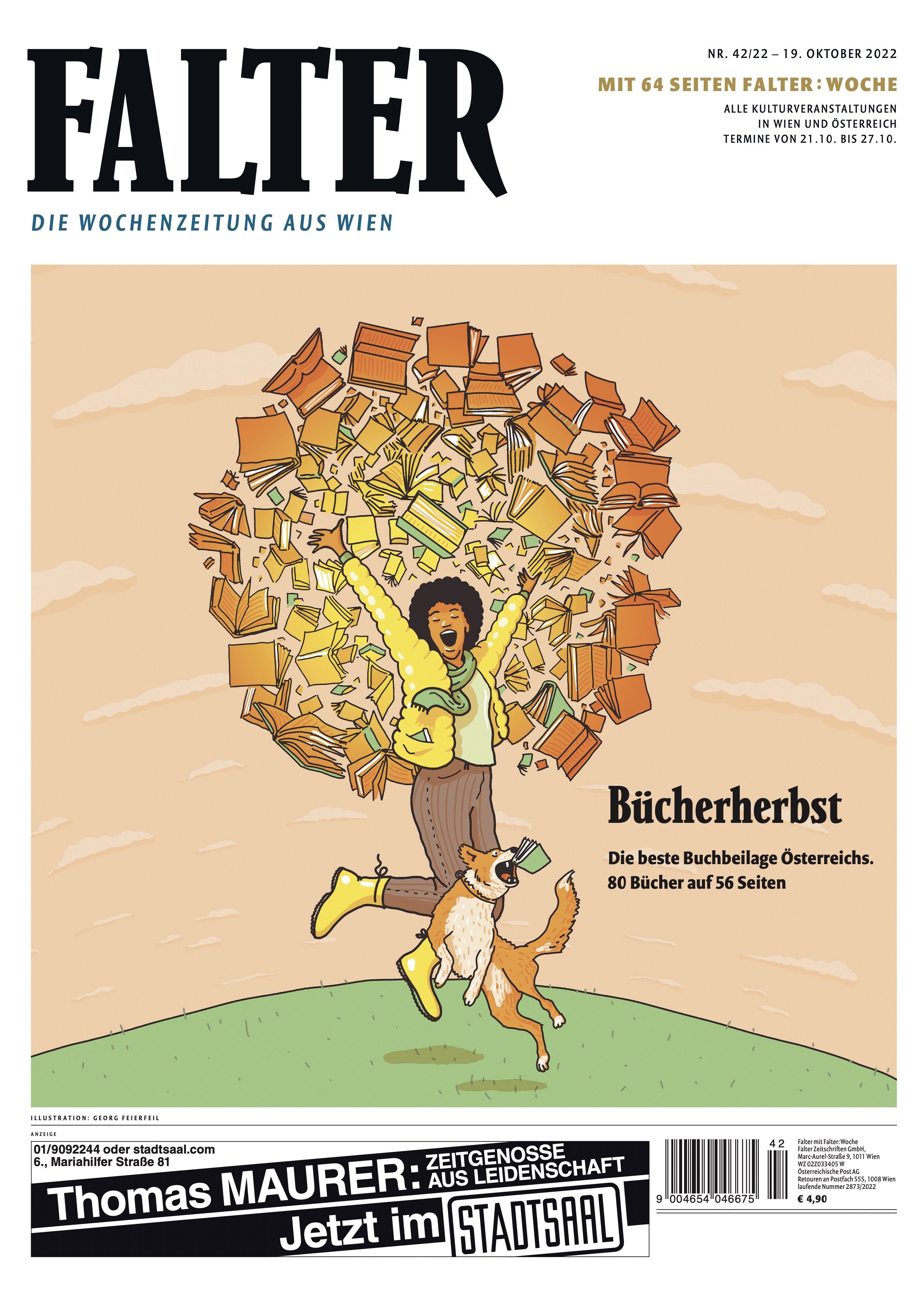
Auf der Suche nach dem Offensichtlichen
Thomas Leitner in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 44)
Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht.“ Mit diesem Satz schließt das faszinierende Buch des Schweizer Literaturkritikers Andreas Isenschmid, eine weitere Würdigung seines literarischen Idols Marcel Proust – er hatte ihm schon 2017 eine elegante Bildbiografie gewidmet. Das Zitat ist nur in mündlicher Form überliefert: Ein Freund des Schriftstellers erwähnte es im Gespräch mit dem Nobelpreisträger Patrick Modiano als Detail eines leider verloren gegangenen Briefs.
Er hat ihn also gesehen, den Elefanten, das Offensichtliche, von dem kaum einer redet, und dies auch ausgesprochen. Isenschmid macht es zum Thema seiner Untersuchung: das Judentum im Proust’schen Universum und dessen Stellenwert für den Autor des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ („À la recherche du temps perdu“).
Wie Proust den Erzähler Marcel darin mit der Homosexualität in einem Maskenspiel von Ver- und Enthüllung der gleichgeschlechtlichen Vorlieben einiger Protagonisten umgehen lässt, zeigt, wie großartig er die Ambivalenz beherrschte. Biografie und Werkrezeption haben sich mit Verve darauf gestürzt. Das Judentum hingegen fand kaum Beachtung.
Das erstaunt aus mehreren Gründen. Schon die Darstellung der Proust’schen Verwandtschaft als einer gutbürgerlichen französischen Familie mit einer eingeheirateten jüdischen Mutter verdreht die Tatsachen. Die Bezugspersonen des jungen Proust, schillernde Figuren, deren Züge sich in der „Recherche“ wiederfinden, stammen alle aus der Familie der geliebten Mutter; der katholische Vater wirkt da als Fremdkörper.
Dann ist nicht zu übersehen, dass zwei der wichtigsten Akteure im Roman Juden sind: der kunstsinnige Gesellschaftslöwe Charles Swann und der zunächst unsympathisch wirkende Albert Bloch, der nach und nach zum Freund des Erzählers wird. Auch dieser, Marcel, verlässt ein einziges Mal seine Deckung und gibt sich als Jude zu erkennen.
Weiters fällt auf, welch großen Raum die Dreyfus-Affäre in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ einnimmt: 1400 Seiten behandeln dieses Drama, das die französische Gesellschaft spaltete, die konfliktreichen drei Jahre machen damit immerhin etwa ein Drittel des siebenbändigen, ein halbes Jahrhundert umspannenden Riesenwerks aus. Was nicht weiter erstaunlich ist, hat doch der Schauprozess wegen Hochverrats gegen den jüdischen Offizier mit einem Fehlurteil und der entwürdigenden Prozedur der Ausstoßung und Verbannung geendet. Er brachte einen Antisemitismus an die Oberfläche, wie ihn das moderne Frankreich noch nie gekannt hatte.
Warum also wurde Proust so spät als jüdischer Schriftsteller wahrgenommen? Zunächst der trivialste Grund: Das französische Publikum der 1920er-Jahre sah den eleganten Träger des Prix Goncourt lieber als „bon français“, man hatte auch kaum Erfahrung im Umgang mit jüdischen Schriftstellern. Der einzige, den man kannte, war „Henri Heine“, und der war ein Dichter aus Deutschland.
Viel wichtiger aber ist Prousts eigener Umgang mit dem Thema. Sein Thematisieren der Homosexualität kann man als kokettes Spiel sehen, in dem die Ambivalenz die Choreografie entwirft. Das Verhältnis der jüdischen Akteure Swann und Bloch, vor allem aber des Erzählers Marcel zu ihrem Erbe ist wesentlich weniger freudvoll und komplizierter. Grobe Missverständnisse können sich da ergeben.
Proust selber ist nicht ganz unschuldig daran. Etwa wenn er Albert Bloch, der im Verlauf des Textes sein Alter Ego wird, bei dessen erstem Auftreten die Haltung eines Schakals attestiert. Isenschmid bezeichnet dies gelassen als „Holzschnitzerei“. Der israelische Historiker Saul Friedländer hingegen ist davon so abgestoßen, dass er Proust in einem sehr kritischen Essay jüdischen Antisemitismus unterstellt – aus seiner Biografie verständlich, aber doch unterkomplex.
Das ist „Der Elefant im Raum“ ganz und gar nicht: Leichtfüßig folgt der Autor durch die Textmassen von Entwürfen, Briefen und Tagebucheintragungen den immer vertrackten, in ihrer Bedeutung sich verschiebenden Spuren des Themas Judentum. Es geht Isenschmid „um die Entfaltung, wenn nicht gar Dialektik der Figuren im Werk“. So schreibt er in Beantwortung einer Detailfrage des Rezensenten mit eben dem Understatement, das ihn als Autor des Buches auszeichnet. Aber bei aller philologischen Akribie lässt er keinen Zweifel: „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sei „jüdisch von der ersten Zeile der Entwürfe bis zum letzten Zettelchen aus der Todesnacht“.