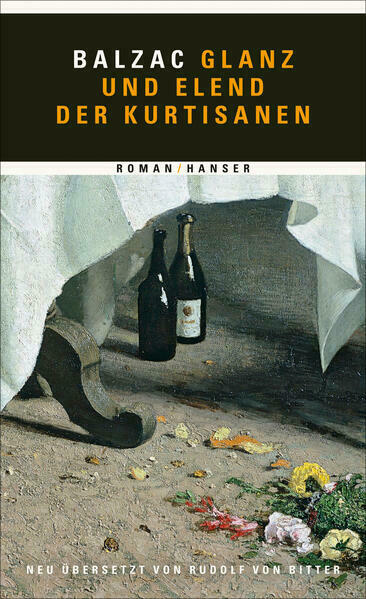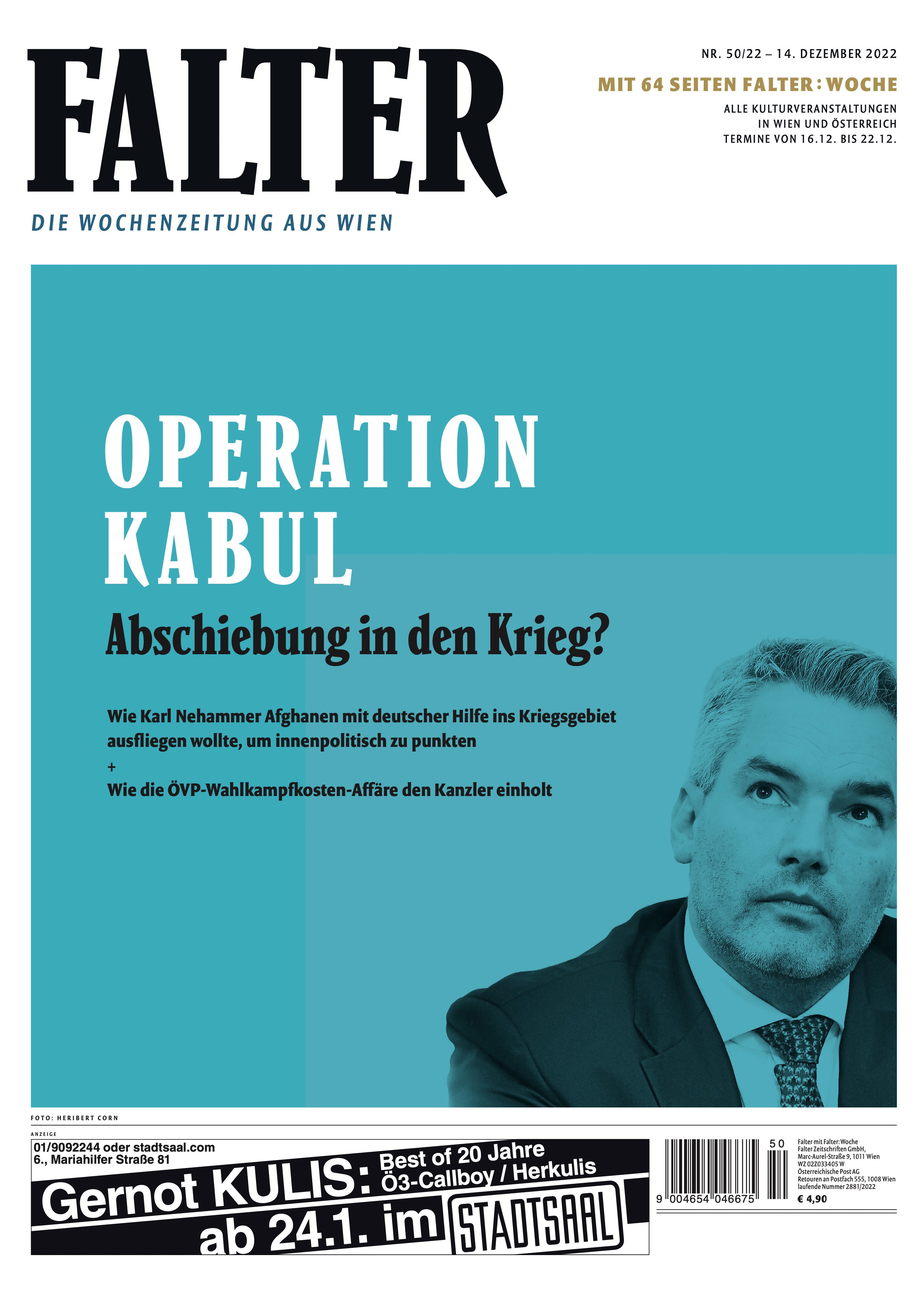
Der zarte Berserker
Klaus Nüchtern in FALTER 50/2022 vom 14.12.2022 (S. 33)
Balzac ist zurück: Zwei Neuübersetzungen und eine fulminante Verfilmung belegen die Aktualität des großen französischen Romanciers und Desillusionisten
Du bist die Hure für die Reichen." "Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das." Diese Sätze, wahre Trouvaillen der Philanthropie, finden sich in den Chats von Thomas Schmid, könnten aber auch aus Honoré de Balzacs "Menschlicher Komödie" stammen.
Dem 1850 im Alter von nur 51 Jahren verstorbenen französischen Meisterrealisten blieb es versagt, sein gigantisches, ursprünglich auf rund 140 Romane angelegtes Gesellschaftspanorama der Restauration, also der Zeit zwischen der Abdankung Napoleons und der Juli-Revolution von 1830, zu vollenden. Das Personal, das Balzacs 91 Romane und Erzählungen bevölkert, ist schier unüberschaubar, weswegen die Statistik auch entsprechend unseriös ausfällt: Stefan Zweig kam auf "dreitausend bis viertausend Personen", andere bieten noch ein-bis zweitausend mehr. Einige der Figuren haben Auftritte in mehreren Dutzend Romanen, der eigentliche Protagonist aber ist keine Person, sondern jenes Medium, das alle miteinander verbindet und buchstäblich am Laufen hält.
"Das Geld ist nicht eine Sache, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis", schrieb Balzacs Zeitgenosse Karl Marx in "Das Elend der Philosophie" und legte ein Jahr später gemeinsam mit Friedrich Engels noch eins drauf: Halb entsetzt, halb bewundernd besingt das "Kommunistische Manifest" die historische Mission der Bourgeoisie: "Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt."
Balzac, der als Reaktionär und Royalist sozialistischer Liebäugeleien unverdächtig war, hätte diesen Satz wohl unterschrieben, in jedem Falle aber um den "Journalisten" ergänzt. In "Verlorene Illusionen", dem bekanntesten Roman des gewaltigen Zyklus, erzählt er vom Aufstieg und Fall des jungen, talentierten und darüber hinaus auch noch ausgesprochen gutaussehenden Dichters Lucien Chardon aus Angoulême.
Aus Ehrgeiz und Statussucht führt er den Namen seiner Mutter, einer Hebamme von adeliger Abkunft, und tritt als Lucien de Rubempré auf - wozu ihn freilich erst ein königliches Dekret legitimieren würde, das zu erlangen er sich im Roman und dessen fulminanter Verfilmung durch Xavier Gioannoli, die kürzlich in die Kinos kam, vergeblich abstrudeln wird.
"Verlorene Illusionen", das ist auch die Geschichte eines Provinzlers in Paris, wo er als Protegé und Geliebter der um einiges älteren Madame de Bargeton in die höheren Kreise eingeführt wird, aber auch tief in das Milieu einsinkt, in dem die Grenzen zwischen Theater, Varieté und Prostitution fließend sind. Vor allem aber partizipiert Lucien am Siegeszug der Boulevardpresse, bei der er mehr als bloß sein Brot verdient und das "Wer zahlt, schafft an"-Prinzip als oberste Maxime gilt. "Man richtet", befand Balzac scharfsichtig, "die Presse zugrunde, wie man eine Gesellschaft zugrunde richtet: indem man ihr alle Freiheiten lässt."
Es ist kein Zufall, dass "Verlorene Illusionen" das Interesse der marxistischen Literaturtheorie auf sich zog. Für den ungarischen Philosophen Georg Lukács war der Roman nichts Geringeres als "die tragikomische Epopöe von der Kapitalisierung des Geistes" und das Paradebeispiel eines realistischen Romans, dem es - unabhängig von der persönlichen politischen Gesinnung des Autors - gelingt, in der Konkretion individueller Figuren das Allgemeine einer Epoche einzufangen.
Ein Jahr jünger als sein Landsmann Auguste Comte, der als Mitbegründer der Soziologie gilt, trieb den rastlos produktiven Balzac der Ehrgeiz um, die ganze Gesellschaft abzubilden. Als Prosaschriftsteller ist er dabei immer mehr Gemischtwarenkrämer als nobler Innenausstatter. Kein Milieu war ihm zu minder, kein Stoff zu billig oder abgegriffen. Wie die Boulevardpresse, so leben auch seine Romane von Klatsch, Kriminalität und Kolportage. Es wird gelogen und betrogen, gehurt und hinterzogen, dass die Paravents wackeln.
In "Glanz und Elend der Kurtisanen", das soeben, mustergültig ediert, in der Neuübersetzung von Rudolf von Bitter erschienen ist, treiben Intrige und Gegenintrige, Spionage und Gegenspionage üppige Blüten. Und angesichts der die Grenzen von gender und race überschreitenden Maskeraden hat es fast den Anschein, als hätte Balzac die Queer Culture vorweggenommen.
Apropos Vorwegnahme: Der Frankfurter Edelmarxist Theodor W. Adorno erkannte in "Illusions perdues" eine Antizipation von Karl Kraus' Attacke auf die Presse und gelangt in seiner "Balzac-Lektüre" zu einer ganzen Reihe funkelnd formulierter Einsichten. "Das Kreditwesen kettet das Schicksal des einen an das des anderen, mögen sie es wissen oder nicht", heißt es über dieses literarische Sittenbild einer Gesellschaft, in der die Jagd nach dem Profit noch "der Blutgier undomestizierter Jäger" ähnle: "Adam Smith' invisible hand wird bei Balzac zur schwarzen Hand an der Kirchhofsmauer."
Im unerbittlichen Kreislauf von Kreditnahme, Abzahlung und Neuverschuldung, der den selbst notorisch klammen Balzac zu der immensen literarischen Produktivität von bis zu acht Romanen im Jahr antrieb, geraten viele unter die Räder, verlieren nicht nur ihr Vermögen, sondern ihr Leben.
Dagegen gefeit sind lediglich unermesslich reiche Personen wie der dauerpräsente "alte Börsenluchs" Baron de Nucingen, dem es letztendlich sogar egal sein kann, ob er ausgenommen wird. Die Figur war auf den Bankier Lionel de Rothschild gemünzt und gab Balzac Gelegenheit, seinen antisemitischen Ressentiments freien Lauf zu lassen.
Selbstmord ist in der "Menschlichen Komödie" stets eine Option. Und wenn er zunächst auch scheitert, so ist er mitunter bloß aufgeschoben. Gioannolis Verfilmung von "Verlorene Illusionen" lässt offen, ob Lucien ins Wasser gehen wird, und den Schluss des Romans weg. Dort erscheint just in dem Moment, in dem der Protagonist zum Suizid entschlossen ist, als Diabolus ex Machina ein spanischer Priester mit einer Passion für schöne junge Männer.
Tatsächlich verbirgt sich hinter dem vermeintlichen Ordensbruder der ebenso sinistre wie charismatische Schwerverbrecher Jacques Collin, der in dem Gewebe aus Verschwörung und Verrat, Betrug und Beschattung, das im Sequel "Glanz und Elend der Kurtisanen" ausgebreitet wird, gleich mehrere Handlungsfäden in der Hand hält und den body count erhöht.
In seiner Verachtung von Recht und Ordnung verkörpert Collin das Böse, beweist aber auch seine Unkorrumpierbarkeit. So zynisch Balzacs Menschenbild mitunter anmuten mag, enthalten seine Romane doch immer auch den Hinweis darauf, dass man sich der Macht des Mammons nicht unterwerfen muss. In einer Welt, in der die Menschen selbst ein unsichtbares Preisschild auf der Stirn zu tragen scheinen, folgen ausgerechnet die Verbrecher und Prostituierten auf der einen und die duldsamen Ehefrauen auf der anderen Seite einem Ethos der Aufopferung, das mit keiner Summe abgeglichen werden kann.
"Immer dieses Geschacher!", hält in "Cousine Bette" eine Frau, die dieses mitzumachen nur allzu bereit ist, ihrem Sugardaddy dessen Knausrigkeit vor. "Ob ein Bourgeois irgendwann einmal das Geben lernt? Wollen Sie sich im Leben mit solchen Rentenverschreibungen Ihre wechselnden Liebesverhältnisse sichern? Ach, ein Krämer und Pomadenhändler!" "Cousine Bette"(1846), einer der letzten Romane Balzacs, ist eine ebenso erschütternde wie komische Phänomenologie weiblichen Wankelmuts und männlichen Zauseltums, in der die trophy wives nach den Gesetzen des monetären Einsatzes zirkulieren. Eine Ausnahme macht da nur die notorisch betrogene Baronin als geradezu überirdisch duldsame Gattin. Aus Sorge um ihren Gatten, ihre Tochter und ihre Anverwandten ist sie sogar bereit, die eigene Ehre als Einsatz auszuspielen.
Letztendlich steckt in dem illusionslosen Prosa-Berserker Balzac ein klandestiner Romantiker, wohnt auch eine zarte Seele in ihm. Dass der notorische Koffein-Junkie auch sehr nahe am Wasser gebaut war, passt da gut ins Bild.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: