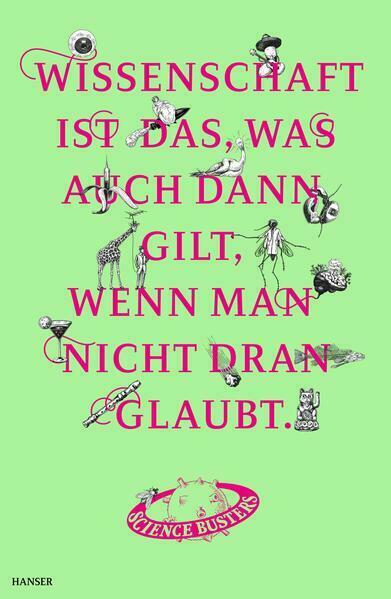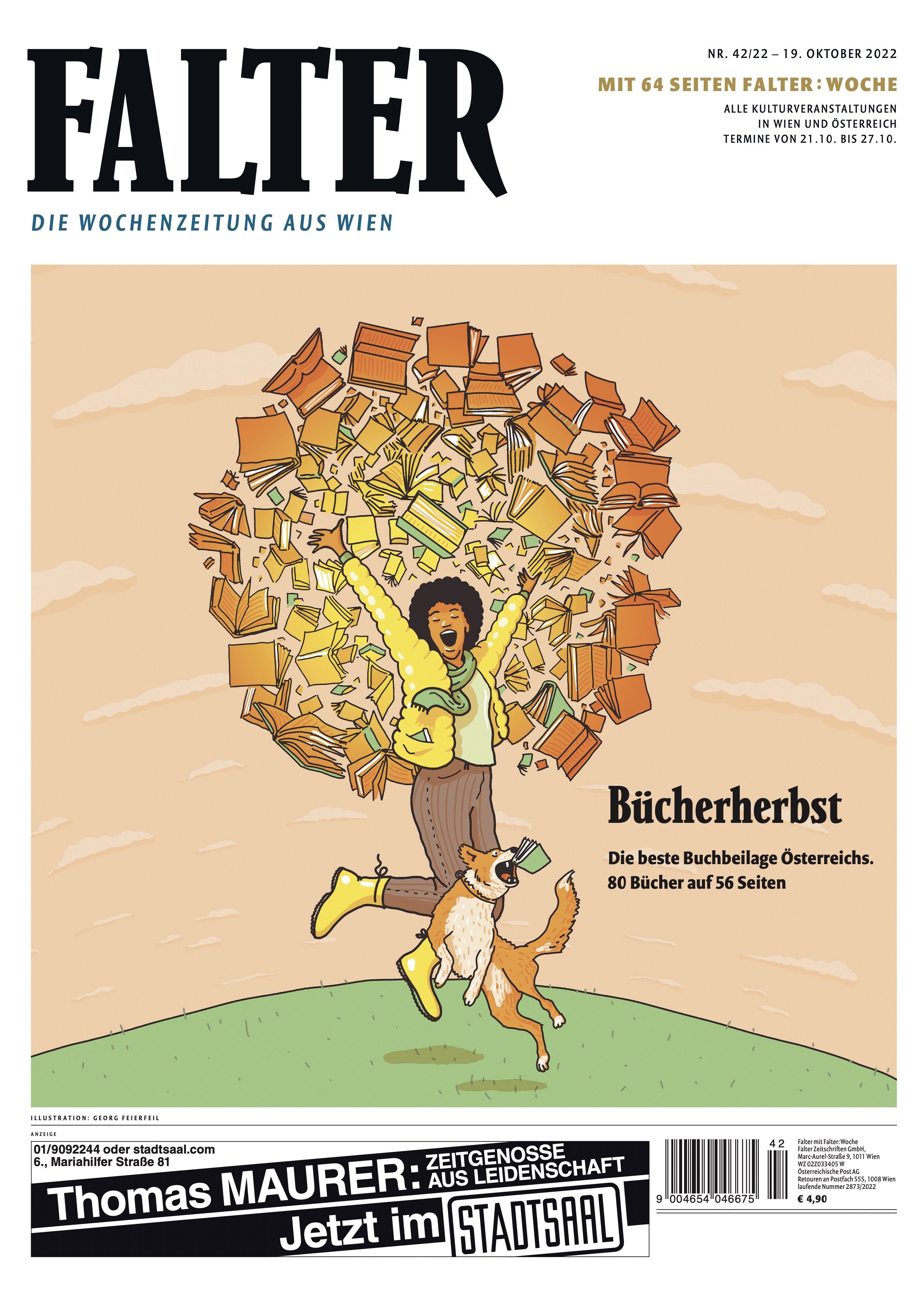
Einstein auf dem Oktoberfest
Oliver Hochadel in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 46)
Im November 2007 schrieb ich für den Falter die Kritik der ersten Bühnenshow der Science Busters: „Kabarettist Martin Puntigam führt als Moderator durch den Abend, die Physiker Heinz Oberhummer und Werner Gruber geben die leicht schrulligen Experten. Das hat schon seinen Unterhaltungswert, mitunter aber auch seine Längen.“ Ob sich die Wissenschaftskommunikation in Österreich durch selbst gebastelte Raketen und das Abbrennen von Teebeuteln verbessern ließe? „In zehn Jahren wissen wir mehr“, schrieb ich.
Jetzt sind es 15 Jahre geworden, aber die Antwort fällt eindeutig aus. Aus den Science Busters (SB) ist eine erfolgreiche Marke geworden, die auch in Deutschland und der Schweiz die Hallen füllt. Neben den mittlerweile über 50 Bühnenshows sind die fidelen Wissenschaftserklärer längst auch im Radio und Fernsehen aktiv.
Insofern haben die SB allen Grund, ein „Jubelbuch“ zu veröffentlichen. Ihr sechstes Opus ist eine Chronik. Jedes Jahr beginnt mit relevanten oder auch skurrilen Wissenschafts-News, danach werden Themen wie HPV-Viren, dunkle Materie, schwarze Löcher, künstliche Intelligenz und natürlich ansteckende Krankheiten abgehandelt. Das mit Blockchain und den Kryptowährungen und warum das Unmengen an Energie kostet, verstehe ich nun in der Tat besser. Und unsere Milchstraße mit ihren 200 Milliarden Sternen stelle ich mir jetzt als Zimtschnecke vor.
Routiniert nutzen die SB den Werkzeugkasten der Wissenschaftsvermittlung: anschauliche Vergleiche, am besten aus dem Alltag, Antizipieren von Leserfragen, Fachbegriffe sofort erklären, Verzicht auf Mathematik und beständige Witzeleien. Der Humor fällt mal subtiler aus – und mal weniger. Augenzwinkernd werden auch „Small-Talk-Hilfen“ geliefert, um Mitmenschen zu erheitern oder zu beeindrucken.
All das ist im schwungvollen SB-Duktus verfasst, der Wiedererkennungswert hat, genauso wie die skurril-lustigen Titel der Bühnenprogramme (das erste hieß: „Im Weltall gibt es keine Bohnen“) und Bücher wie „Warum landen Asteroiden immer in Kratern?“. Der satzlange Jubelbuch-Titel könnte auch das Motto der SB sein: „Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt“.
Aber auch Selbstkritik wird geübt. So äußerten die SB 2009 noch Skepsis, ob das mit der Erderwärmung nicht etwas übertrieben sei. Mittlerweile ist der menschengemachte Klimawandel ein Dauerthema der Shows und auch des Buchs. „Heute würden wir vermutlich nicht mehr auf die Bühne gehen und arglos ein Hochfest des Schweinsbratens zelebrieren“, hat doch „Fleischkonsum keinen geringen Anteil am Klimawandel“. Das Originalrezept von Werner Gruber ist dennoch abgedruckt.
Am Ende jedes Kapiteljahrs erzählen die SB auch ihre eigene Geschichte: ihre beeindruckend lange Liste an Ehrungen (sowohl Kabarett- als auch Kommunikationspreise), kleine und große Bühnendesaster – und wie sich die „schärfste Science Boygroup der Milchstraße“ in die Kelly Family der Wissenschaft verwandelte. Heinz Oberhummer verstarb im November 2015 unerwartet, Werner Gruber zog sich zur selben Zeit aus gesundheitlichen Gründen zurück. Mittlerweile besteht das Ensemble aus neun Personen, darunter auch der Astronom und Science-Blogger Florian Freistetter. Im Interview mit ihm und dem Gründungsmitglied Martin Puntigam (dem „Master of Ceremony“, MC, Bühnenoutfit hautenges rosa Leiberl) geht es um das Erfolgsgeheimnis der SB und was sich daraus für die Wissenschaftskommunikation in Österreich lernen ließe.
Falter: Der Wissenschaftsminister lobt die Science Busters, sie spielen vor ausverkauften Hallen. Und dennoch liegt Österreich laut Eurobarometer-Umfrage in puncto Wissenschaftsverständnis und -akzeptanz im europäischen Vergleich weiterhin auf den letzten Plätzen. War Ihre Aufklärungsmission in den letzten 15 Jahren wirkungslos?
Martin Puntigam: Zum einen: Wir Science Busters sind weder eine staatstragende Aktion noch ein Rationalismusexporteur. Wir sind ein Liveshowprojekt und werden über Zuschauerzahlen evaluiert, nicht über das Eurobarometer. Zum anderen: Wenn man in einem Land wie Österreich lebt, in dem so absurde Dinge geglaubt werden, wie dass ein unsichtbarer Herrgott seinen Sohn zur Erlösung auf die Erde schickt, dann dauert das halt. Wir bilden uns ja nicht wenig auf uns ein, aber es wäre vermessen zu glauben, dass man hierzulande in ein paar Jahren eine fundamentale Änderung in der Einstellung zur Wissenschaft erreichen könne.
Florian Freistetter: Wenn man Wissen vermitteln möchte, lautet die Frage, worauf man den Fokus legt. Bei einem öffentlichen Vortrag an der Uni liegt dieser auf der Wissenschaft. Bei den Science Busters ist der Fokus ein anderer. Wenn die Zuschauer am Ende denken: „Das war ein cooler Abend“, dann ist das ein Erfolg. Wenn sie außerdem noch etwas über Wissenschaft gelernt haben – gut. Jedenfalls haben sie gesehen, dass es Spaß machen kann, sich mit Astronomie oder Biomedizin zu beschäftigen. Das ist unser grundlegendes Ziel.
Puntigam: Ich war als Ministrant vom Hochamt beeindruckt. Nur gibt es in der Messe keine Ironie und keine Witze. Aber wenn man die Hierarchie umdreht, wird der Ministrant zum Master of Ceremony und die Hohepriester, die Wissenschaftler, zu Co-Zelebranten. Ich bin als MC mit dem Publikum verbündet. Die beiden Wissenschaftler müssen sich Mühe geben, dass ich es begreife – und dann können es alle verstehen.
Kabarett als humoristisches Hochamt?
Puntigam: Ja. In der katholischen Tradition gibt es Gabenbereitung und Kommunion, weil diese Reihenfolge dramaturgisch gut ist. Leute erst belehren, dann gibt es was zu essen und am Ende den Segen.
Belehren? In der Einleitung Ihres neuen Buchs fragen Sie selbst, ob Ihre Shows nicht bloßer Frontalunterricht seien.
Freistetter: Das ist das grundlegende Dilemma einer Bühne: Sie trennt Darsteller vom Publikum. Beim Theater ist das kein Problem, aber wer Wissenschaft kommunizieren möchte, sollte nicht ins Dozieren verfallen. „Hört gut zu, dann seid ihr gescheiter als vorher.“ Wir haben uns also gefragt, wie man das Publikum besser einbeziehen könnte.
Puntigam: Wir machen nicht diese Foren, wie sie nach Vorträgen üblich sind, wo das Mikrofon herumgeht und die Leute sich wieder nichts zu sagen trauen. Wir schauen eh schon komisch aus, machen Witze über uns und bleiben auf Augenhöhe mit dem Publikum. Und wenn alles gutgeht, duftet es am Ende der Show und es gibt gratis was zu essen oder zu trinken. Dann kann der Zuschauer mit uns übers Essen reden, übers Wetter und dann übers Leiberl.
Was steht auf der SB-Speisekarte?
Puntigam: Werner Gruber hat Wiener Schnitzel und Gulasch gekocht. Helmut Jungwirth hat Laugengebäck zubereitet, Florian das Bier kalt destilliert. Bei der Jubiläumssendung wird es einen SB-Gin geben.
Freistetter: Ich werde ja als Astronom vorgestellt und bastle auf der Bühne einen kosmischen Cocktail. Am Ende haben wir alle ein Glas in der Hand und die Leute fragen, was sie schon immer mal von einem Astronomen wissen wollten. Wir reden nach der Show immer noch 15 Minuten oder sogar länger mit dem Publikum.
Puntigam: Ich finde es das fadeste Kabarett, wenn die, die drinnen sitzen, alle meinen, die Bösen und Blöden seien alle draußen. In Österreich findet man im Publikum des Kabaretts ein buntes Spektrum. Vorige Woche hat uns eine Frau als Knechte der Pharma-Lobby beschimpft – wir hatten gezeigt, was die endlose Verdünnung der Wirkstoffe in der Homöopathie bedeutet, sie aber hatte mit Homöopathie gute Erfahrungen gemacht. Wir erreichen also nicht nur Gläubige, die zu uns in den Gottesdienst kommen, um zu hören, was sie eh schon wissen.
Geht die Kommunikation auch über die Show hinaus?
Freistetter: Ja, zum Beispiel unsere Show „Global Warming Party“. Da zeigen wir mit rot gefärbtem Wasser, wie viel CO2 Menschen im Laufe der Geschichte in die Atmosphäre reingegeben haben. Und wie wenig Spielraum uns bleibt, um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen. Wir bekommen E-Mails etwa von Lehrern, die genau wissen wollen, wie viel Wasser und welche Gefäße man für einen Nachbau in der Schule braucht.
Puntigam: Weil man mit uns einfach kommunizieren kann, kriegen wir auch viele Fragen von Menschen. Sie glauben, dass wir es so erklären können, dass sie es verstehen. Das haben wir nach 15 Jahren zumindest erreicht.
Freistetter: Man will die Wissenschaft an die Öffentlichkeit kommunizieren. Das eine ist aber genau so divers wie das andere. Manche Leute mögen kein Kabarett. Es nützt also nichts, wenn nun die gesamte Wissenschaftskommunikation auf lustig getrimmt wird. Es geht nicht darum, noch mehr Kabarettisten mit rosa Leiberln anzuschaffen, sondern möglichst viele Kanäle abzudecken und auch auszuprobieren.
In Österreich gibt es Tage der offenen Tür, die Lange Nacht der Forschung ...
Freistetter: Alles wunderbar. Wichtig aber wären Konzepte für jene Menschen, die noch nicht wissen, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Zum Beispiel im Wirtshaus: „Science in the Pub“. Wir probieren die Vielfalt im Kleinen. Uns gibt es nicht nur als Bühnenshow, sondern auch als Buch, Podcast, Radioshow und im Fernsehen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit, die Wissenschaftskommunikation in Österreich alleine zu stemmen. Je mehr das machen, desto besser für alle.
Die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny fordert, dass die Wissenschaftskommunikation auch zeigen sollte, wie Forschung betrieben wird und wie Forschende zu ihren Ergebnissen kommen. Können die SB auch den Alltag, die Leiden und Freuden der WissenschaftlerInnen vermitteln?
Freistetter: Wir vermitteln in einer Show nicht nur Inhalte. Wenn es die Geschichte hergibt, kommen auch die Menschen vor, die das erforscht haben. Einstein auf dem Oktoberfest ist so ein Beispiel. Auch wir stehen als Privatpersonen auf der Bühne. Kommt ein neues Ensemblemitglied dazu, stellen wir das mit Fotos aus der Kindheit und dem Studium vor. Je unschmeichelhafter die Bilder und Anekdoten für uns sind, desto wahrscheinlicher, dass wir sie auf der Bühne zeigen. Menschen wollen sich was über Menschen anhören.
Puntigam: Ab und zu erzählen wir über die Mechanismen der Wissenschaft. Beispiel Autismuslüge: also die irrige Behauptung, dass die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln Autismus auslöse. Elisabeth Oberzaucher hat in einer Fernsehsendung und auf der Bühne erklärt, wie diese Studie im angesehenen Medizinjournal The Lancet erscheinen konnte. Und warum es so lange dauerte, bis die fehlerhafte Publikation zurückgezogen wurde. In der Pandemie konnten wir in unserer FM4-Kolumnen-Serie erklären, wie aus einer Studie eine publizierte Studie wird, was Preprints und Peer Reviews sind. Viele dieser Begriffe hatten die Menschen vorher noch nie gehört.
Die SB starteten als Boygroup, das aktuelle Hauptprogramm machen drei Männer. Tradiert das nicht ein überkommenes Bild von männlicher Naturwissenschaft?
Puntigam: Das hat sich so ergeben, zu Beginn mit mir und zwei Physikern. Wie die Wissenschaft ist auch das Kabarett eher eine männliche Angelegenheit. Das ändert sich leider nur langsam. Mittlerweile sind wir neun Ensemblemitglieder, darunter drei Wissenschafterinnen. Dass derzeit das Kernensemble aus drei Männern besteht, also ich, Florian und Martin Moder, hat auch berufspraktische Gründe. Alle anderen haben eine Praxis oder lehren an der Uni. Die müssten Überstunden schinden und ihren Urlaub aufbrauchen, um auf Tour zu gehen, während wir drei selbstständig sind.
Freistetter: Möglicherweise sind Wissenschafterinnen in der Öffentlichkeit etwas zurückhaltender. Bedenken Sie, was der deutsche Virologe Christian Drosten in der Covid-Debatte alles an Beleidigungen ertragen musste. Die Frauen würden dann noch zusätzlich den Sexismus abkriegen. Aber in den nächsten 15 Jahren wird sich das SB-Ensemble sicher noch wandeln.