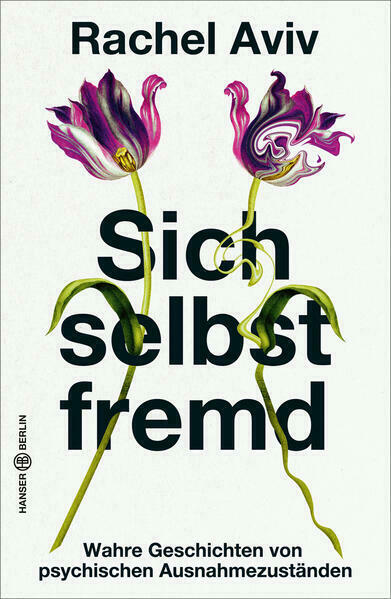Bin ich meine Diagnose?
Sebastian Kiefer in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 29)
Die Entdeckung der ersten (modernen) Psychopharmaka in den 1950er-Jahren erneuerte die Hoffnung, psychiatrische Erkrankungen könnten allein auf der Basis objektiver, neurobiologischer Befunde diagnostiziert und behandelt werden. Milliardenmärkte für Psychopharmaka entstanden, die langfristigen Folgen blieben unerforscht. Damit einher ging eine Umdeutung von Formen des Leidens wie Einsamkeit, Erschöpfung, Bindungskonflikten, Zwängen, Konzentrationsmangel oder Impulsivität in Krankheitszustände, zu deren Behebung es spezialisierter Therapeuten und Medikamente bedarf. Diese Umdeutung ist heute Teil des Selbstverständnisses der meisten Bürger geworden – gipfelnd im Outing als „Betroffene“ von ADHS, Burnout, Depression, Bipolarität oder Borderline.
Diese massenmediale Kultur hat die literarisch ambitionierte psychiatrische Fallgeschichte des 20. Jahrhunderts eines Alexander Romanowitsch Lurija oder Oliver Sacks verdrängt. Sacks verstand die (gestörten) Weisen, das Ich und die Welt zu erleben, als Ausdruck einer individuellen (beschädigten) Persönlichkeit. Heute versteht man Ich-Identität eher als Produkt von kollektiven Zuschreibungen des Geschlechts, der Krankheit, des sozialen Status. Rachel Aviv, Redakteurin des erlesenen kulturkritischen Journals The New Yorker, wagt eine Erneuerung der literarisch-psychiatrischen Fallstudie, indem sie die neuen Paradigmen der sozialen Konstruktion und Momente des Outings integriert. Sie tut es brillant.
Die Autorin selbst war gerade einmal sechs Jahre alt, als sie in eine Psychiatrie eingewiesen wurde: Sie ahmte ihre beste Freundin nach, die Nahrung (meist) verweigerte. In der Klinik lernte sie, ältere Mädchen zu bewundern, die die Kontrolle über Nahrung und Körpergewicht mit Ehrgeiz betrieben und das zu einem Teil der eigenen, prekären „Identität“ machten. Darunter Hava, jüdisch wie Rachel, attraktiv, lebendig, auffallend scharfsinnig in der unablässigen Suche nach Selbsteinsicht. Sie fand trotz oder wegen jahrzehntelanger Medikationen und Therapien wie viele Psychiatriepatienten nie mehr aus dieser artifiziellen Art von „Identität“ heraus und starb früh. Ein Schicksal, vor dem Rachel Aviv vielleicht nur der Zufall bewahrte.
Naomi, Black American Woman aus den Sozialghettos, in denen seit Generationen frühe Schwangerschaften und brüchige Beziehungen, geringe Bildungschancen, Alltagsrassismus und Kriminalität das Leben prägen, versucht, heroisch ihre Würde auch während einer langen Haftstrafe nach einem Suizidversuch (mit Kindern) zu verteidigen, der für sie weniger eine Folge von Psychosen denn der nackten Verzweiflung war. Bapu wiederum, in den 1940ern in eine traditionell lebende Brahmanenkaste geboren, behauptet eigensinnig ihr Selbst, indem sie sich weigert, ihren mit Halluzinationen einhergehenden Drang nach spiritueller Hingabe und Askese als Zeichen von Schizophrenie deuten und behandeln zu lassen.
Ray dagegen wird im besten Alter durch seelische Störungen aus einem Leben als erfolgreicher Arzt gerissen. Diese zu verstehen, dazu reicht die zweite Hälfte des Lebens, herumirrend zwischen Medikationen und wechselnden Moden der Therapie, nicht aus. Das hätte auch Laura Delano passieren können, die im Jugendalter in die Fänge psychiatrischer Diagnosen und Medikationen geriet, dann jedoch zur Aktivistin wurde, die andere Betroffene bei der Befreiung von Psychopharmaka begleitet.
Avivs Buch zeigt: Nirgendwo existiert eine scharfe Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit, nirgendwo eine einzige Ursache des Leidens, nirgendwo ein wahres Ich „hinter“ den wechselnden Deutungsmustern. Und die Autorin beweist, dass keine Blogkultur dieser Komplexität gerecht werden kann – sondern nur aufwendig recherchierte, diverse Zugänge integrierende dokumentarische Erzählungen, die auf einfache Erklärungen und Rezepte verzichten.