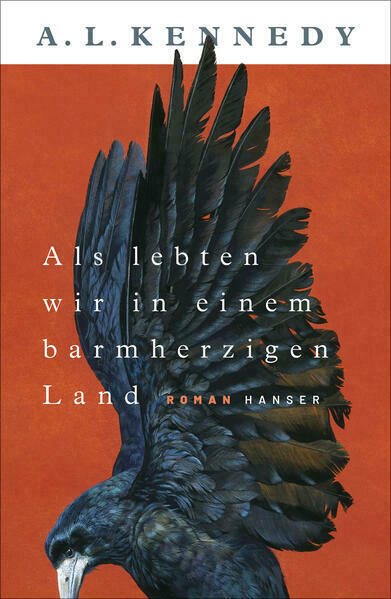Rumpelstilzchen im Lockdown
Klaus Nüchtern in FALTER 16/2023 vom 19.04.2023 (S. 29)
Vor drei Jahren war der Lockdown noch ein Sujet für Leitartikler, Essayisten, alerte Zeitdiagnostiker und alle, die vorne mit dabei sein wollten; mittlerweile ist er in den literarischen Mainstream gewandert. Wer von den 2020ern erzählen will, kommt um ihn nicht herum.
Nach Ian McEwan ("Lektionen") und Virginie Despentes ("Liebes Arschloch") hat sich nun auch A. L. Kennedy dieses Themas angenommen. Während es bei McEwan und Despentes ein bisschen wie Dienst nach Vorschrift aussah -"muss halt auch noch rein, weil wichtig und aktuell" -, sind Isolation, Maskenvorschrift und Maßnahmenchaos bei Kennedy essenzieller Bestandteil von "Als lebten wir in einem barmherzigen Land", einem Buch, das von nichts weniger als dem Kampf zwischen Gut und Böse handelt.
Die einzige Kontinuität im Werk der 57-jährigen Schottin bildet vermutlich der Umstand, dass deren Protagonisten und Protagonistinnen meilenweit von jeder Durchschnittsbiografie entfernt und allesamt einigermaßen neben der Spur sind.
Von allen vorangegangenen Büchern unterscheidet sich Kennedys zehnter Roman freilich dadurch, dass er bislang nur auf Deutsch vorliegt. Der Originaltitel, "Alive in a Merciful Country", ist zwar angeführt, ob und wann das dazugehörige Buch auf Englisch erscheint, ist allerdings nicht bekannt.
An ungeklärten Fakten und mysteriösen Umständen herrscht auch im Roman selbst kein Mangel. So viel aber ist immerhin klar: Die Ich-Erzählerin, Anna Louise McCormick, arbeitet in einer alternativen Grundschule als "Lehrerin für kleine Menschen", hat einen fast erwachsenen Sohn namens Paul und einen Geliebten, den sie F. L. nennt und der gerade auf einer schottischen Insel festsitzt, während Anna von ihrer Londoner Wohnung aus per Skype mit ihm kommuniziert.
Als typische Kennedy 'sche Antiheldin ist Anna so etwas wie ein wandelndes Oxymoron: eine pessimistische Menschenfreundin, die sich zur Hoffnung verpflichtet fühlt; eine resolute Heulsuse, die sanftmütig und sarkastisch zugleich ist und ihre desillusionierenden Einsichten in Form witziger Bonmots absondert: "Fünfte Klasse ist das beste Alter. Zu der Zeit merkt das zwar niemand, aber mit zehn, elf Jahren sind wir wahrscheinlich auf dem Gipfel unseres Lebens. Danach kommen bloß noch Sex, Angstattacken und körperlicher Verfall."
Die Weltsicht Annas ist getragen vom Mut der Verzweiflung und von trotziger Zuversicht. Alles geht den Bach runter, aber alle Menschen guten Willens können und müssen dennoch etwas dagegen tun: "Ich schreibe dies mit der Hand auf einem Block aus Recyclingpapier. Ich bin so ein Mensch, der seinen CO2-Fußabdruck reduziert, obwohl wir bereits dem Untergang geweiht sind."
Mit anderen Worten: Anna ist ein "Gutmensch", ist es immer schon gewesen. In den 1980ern war sie Teil eines anarchoclownesken Kollektivs namens UnRule OrKestrA, das eine "Ridikulus RevOluTion" anzuzetteln versuchte. Die Artisten-Truppe hat Kindertheater für streikende Bergarbeiterfamilien gemacht und gegen die nukleare Aufrüstung protestiert - was ihren Mitgliedern Jahrzehnte später einen lachhaften Prozess wegen eines Brandanschlags auf einen Atomstützpunkt einträgt.
Es ist ein ungleiches Match, das immer wieder neu aufgelegt wird: Auf der einen Seite die Menschen mit Kazoos und bunten Bällen, auf der anderen die Horrorclowns aus der Politik und all die anderen "Stilzchen". Unter diese Kategorie fallen - frei nach dem Märchen vom "Rumpelstilzchen" - für Anna all jene, die aus Gier und Geltungssucht ihren Mitmenschen Schaden zufügen; Monster, derer man nur Herr werden kann, indem man sie wie im Märchen beim Namen nennt und als Ungeheuer kenntlich macht.
Eine besondere Spezies von Stilzchen ist Annas Gegenspieler "Buster". Er, der seinen Spitznamen dem von Anna bewunderten Stummfilm-Komiker Buster Keaton verdankt, ist ein Spitzel und Verräter, der das OrKestrA unterwandert hat und sich danach von einem sinistren Typen zum Killer ausbilden ließ. Ohnedies nahe am Verschwörungsnarrativ gebaut, biegt der Roman mit diesem Crime-Plot endgültig ins Obskure ab. Was genau diesen Buster umtreibt, der so behände die Identitäten zu wechseln weiß, um das Vertrauen seiner Opfer zu gewinnen, lässt sich allenfalls erahnen.
Auskunft darüber geben seine sprachlich hochmanierierten Aufzeichnungen, in denen er von seinen Taten berichtet und die er Anna zukommen lässt. Mit Datum versehen und in einer eigenen Typografie gesetzt, unterbrechen sie die ohnedies nicht sonderlich zielgerichtete und mit zahlreichen Rückblenden versehene Erzählung der Protagonistin. Schenkt man ihnen Glauben, so haben die von Buster Ermordeten als besonders fiese Stilzchen den Tod allemal verdient.
Wirklich schlau wird man aus den hochmanierierten Auslassungen, die immer wieder zu völlig verquastem Geraune verkommen, aber nicht: "Als das Land in den Lockdown ging, lag ich nachts wach und hörte das Rauschen der Mitternachtsdinge, die über dem Gedankenbild von England tobten und sich daran gütlich taten."
Als Selbstvergewisserungsprotokoll einer Menschenfreundin, die an der Indolenz ihres Landes verzweifelt, geht einem Kennedys Roman zu Herzen. Als Thriller ist er ein Verhau. Sollte die "Originalausgabe" eines Tages doch noch erscheinen, ließe sich immerhin ein Fehler korrigieren: Buster unterhält ein mystisch-mysteriöses Verhältnis zu Raben. Der Vogel auf dem Cover ist allerdings eindeutig eine Saatkrähe.