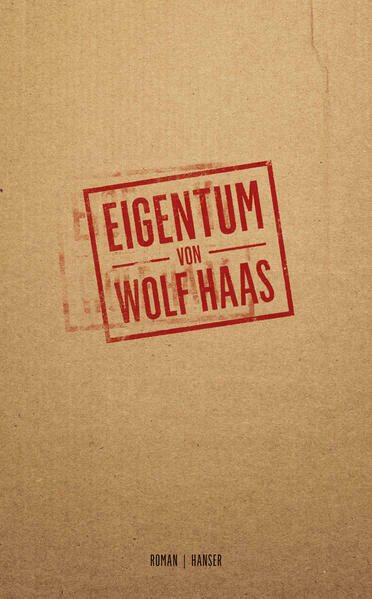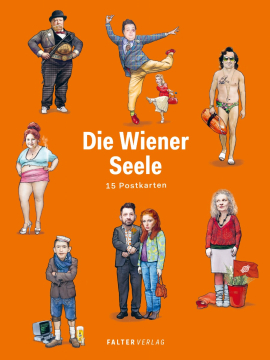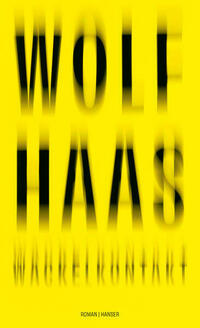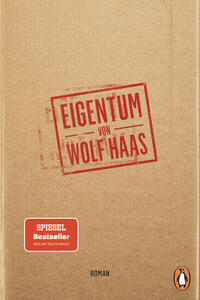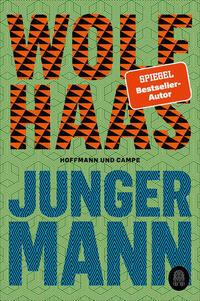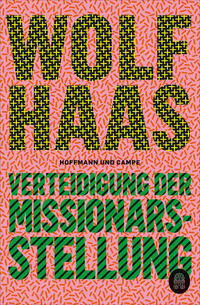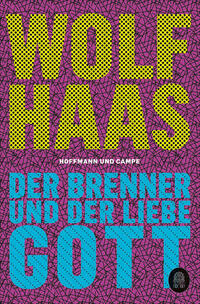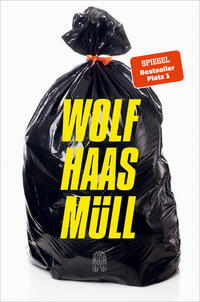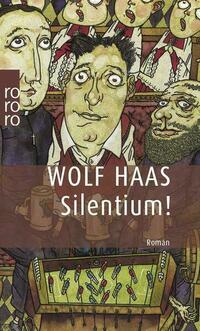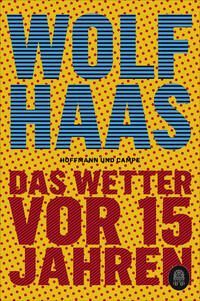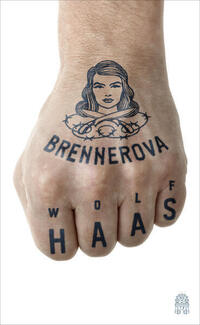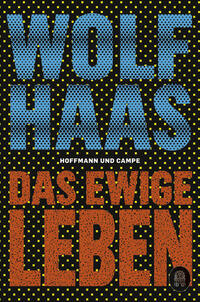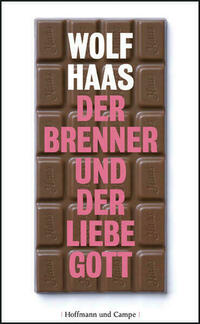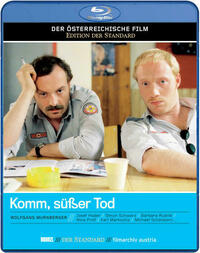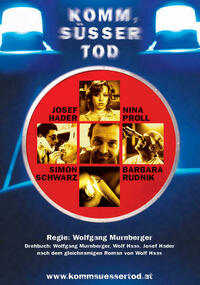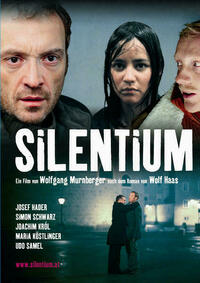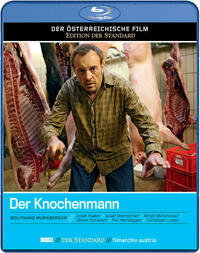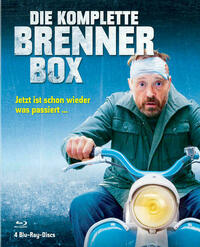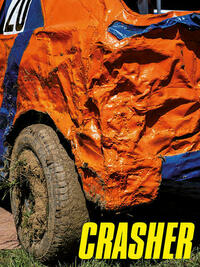Mutters Hände waren immer kalt
Klaus Nüchtern in FALTER 36/2023 vom 06.09.2023 (S. 25)
Den Auftakt zum Reigen der Mutterbedichtung im heurigen Herbst macht ein Klassiker des Genres. Cordelia Edvardsons "Gebranntes Kind sucht das Feuer" war 1984 im schwedischen Original und zwei Jahre später auf Deutsch erschienen - was der Hanser Verlag, der ihn nun wieder herausgebracht hat, dezent verschweigt. Immerhin: Die Neuübersetzung stammt von Ursel Allenstein, die zuletzt der großartigen "Kopenhagen-Trilogie" der Dänin Tove Ditlevsen (1917-1976) zu einem vielbeachteten Comeback verholfen hat.
Cordelia Edvardson - ihren Nachnamen verdankt sie einem schwedischen Journalisten und Schriftsteller, mit dem sie nach dem Krieg verheiratet war -kommt 1929 als ledige Tochter der deutschen Dichterin Elisabeth Langgässer (1899-1950) in München zur Welt. Den leiblichen Vater, einen jüdischen Staatsrechtler, bekam sie nie zu Gesicht; die nach den rassistischen Nürnberger Gesetzen selbst als "Halbjüdin" eingestufte Mutter hatte Cordelia über deren Herkunft im Dunkeln gelassen.
Diese vorenthaltene Identität ist ein Leitmotiv des "Romans" und klingt gleich in der Ouvertüre an: "Das Mädchen hatte schon immer gewusst, dass etwas mit ihm nicht stimmte", wird die vorerst namenlos bleibende Protagonistin in der dritten Person eingeführt und kurz darauf als "das Gegenbild einer Prinzessin" vorgestellt, "ein dunkles, pummeliges, böses und bockiges kleines Kind", das die "nachdenklichen, traurigen braunen Augen [ ] des jüdischen Vaters" geerbt hat.
Edvardsons autobiografischer Roman sollte den Mythos von der untadeligen, der christlichen Mystik nahestehenden Dichterin Langgässer ein für allemal zerstören. Er ist aus großer Distanz zum Geschehen erzählt, unternimmt aber zugleich den Versuch, die kindlich-naive Perspektive der in Berlin aufwachsenden Tochter zu rekonstruieren, die unter der Kälte ihrer flamboyanten Mutter leidet und diese dennoch bewundert.
"Gebranntes Kind sucht das Feuer" ist freilich nicht nur persönliche Abrechnung, sondern ermöglicht auch erschütternde Einblicke in den alltäglichen Überlebenskampf unter der Nazi-Diktatur. Verschweigen, Verstellung und Verrat sind dessen alltägliche Voraussetzungen, die Cordelia naturgemäß nicht durchschaut: Warum sie dem Bund Deutscher Mädel nicht beitreten darf, ist ihr unbegreiflich.
Die Mutter lässt Cordelia adoptieren und verschafft ihr dadurch einen spanischen Pass. In einer der schrecklichsten des an schrecklichen Szenen nicht armen, aber auch überinstrumentierten und vor dunkelschwarzem Kitsch nicht gefeiten Romans wird sie von einem perfiden Beamten erpresst, die Doppelstaatsbürgerschaft und damit den Judenstern zu akzeptieren, um die Mutter davor zu bewahren, wegen Hochverrats im KZ zu landen. Diese wiederum nimmt Cordelias Deportation, die sich allen Anstrengungen zum Hohn nicht verhindern lässt, sehr gefasst auf, "denn erstens war es", wie sie einer Freundin schreibt, "ja wirklich ,nur' Theresienstadt (und nicht etwa Polen) und zweitens ging sie als Säuglingsschwester [ ], was sie, glaub ich, mit großem Stolz erfüllte".
Was die Mutter nicht ahnen kann, ist, dass Cordelia Polen, ja die persönliche Begegnung mit dem "Todesengel" Josef Mengele und der berüchtigten Oberaufseherin Maria Mandl -die Österreicherin wurde 1948 als Kriegsverbrecherin gehenkt - nicht erspart bleiben. In Auschwitz wird sie befreit und vom Roten Kreuz nach Schweden gebracht, wo sie sich gegen das als scheinheilig empfundene Mitleid "einer für ihr Weltgewissen bekannten und geachteten schwedischen Familie" ebenso wappnen muss wie gegen die Verunglimpfung als "deutsches Schwein". 1973, während des Jom-Kippur-Kriegs, wandert sie schließlich nach Israel aus, worüber ein letztes, sehr kurzes Kapitel des Romans Auskunft gibt.
In einem Brief bittet Elisabeth Langgässer, die gerade an einem Roman über eine Überlebende arbeitet, ihre Tochter, die 83 Jahre alt werden sollte, "von ihrem Alltag in Auschwitz" zu erzählen: "Die Tochter antwortete, berichtete, so gut sie konnte. Als sie den Roman der Mutter später las, erkannte sie ihre Erinnerungen nicht wieder."
Die Mutter von Maxim Biller, die 2019 verstorbene Schriftstellerin Rada Biller, hätte sich in Aljona Grinbaum ganz sicher wiedererkannt, ist die Protagonistin aus "Mama Odessa" doch so offenkundig nach ihr modelliert wie der Ich-Erzähler nach seinem Erfinder. Dass die Billers 1971 nicht -wie die Grinbaums -aus Odessa, sondern aus Prag nach Hamburg emigriert sind, fällt selbstverständlich unter Freiheit der Fiktion.
Seit Jahrzehnten performt Biller, 62, in Funk, Fernsehen und Feuilleton das Drama des begabten Söhnchens, so auch in seinem jüngsten und angeblich letzten Roman. "Ich wollte Wirklichkeit, echte Wirklichkeit, nicht bloß Literatur", bekennt sein Alter Ego Mischa einmal. Der echte Maxim Biller wiederum hatte im März 2022 angekündigt, in Zukunft kein Schriftsteller mehr sein zu wollen, nachdem er feststellen musste, dass nicht einmal seine Romane den Ukraine-Krieg hatten verhindern können. Eine gewaltige Kränkung, keine Frage. Da ist es gut, wenn wenigstens die Mama zu ihrem Buben steht - so wie Aljona Grinbaum: "Du weißt, dass du besser bist als andere, das ist dein Kapital", lässt sie diesen in einem der zahlreichen, nie abgeschickten Briefe wissen, die der Sohn erst nach ihrem Tod zu Gesicht bekommen wird.
Ein Hauch von Inzest weht durch den Roman, wenn Mama Odessa "mit ihren tiefschwarzen Haaren und ihren weichen, weiblichen Bewegungen" dem Sohn von ihren Bettgeschichten aus Studententagen schreibt und gesteht, dass sie sich den jungen Dichter von damals zurückwünscht - oder "jemanden wie dich". Der Sohn wiederum erzählt seiner "warmen, aber fernen Mutter" von all den Frauen, "die mich liebten und nicht wollten" und die natürlich allesamt der Mame nicht gut genug sind für ihren Mischa.
Abseits von solchen Klischees erweitert Biller seine reichlich konfus und unkonzentriert erzählte, von den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts überschattete Sippengeschichte um einen Vater, der mit seinem Zionismus nicht nur seiner Frau gehörig auf die Nerven geht, sondern auch einen Giftanschlag des KGB provoziert. Und schließlich ist da auch noch der in Odessa zurückgebliebene Vater der Mutter, ein Maler, den die Tochter nie wiedersehen und der im Roman mit seinem Brief an den elfjährigen Enkel das letzte Wort behalten wird: "Ich glaube, deine Mama ist sehr talentiert. [ ] Aber du bist noch viel talentierter als sie und ich, das weiß ich genau." Und so ist es dann, wie jeder weiß, auch in der echten Wirklichkeit gekommen.
Mutter-Romane sind ein top Medium nicht nur der Abrechnung, sondern auch der Selbstzerknirschung. Jetzt, wo die Mama gestorben oder am Sterben ist, bietet jahre-und jahrzehntelang Versäumtes reichlich Anlass, sich schuldig zu fühlen. Mira, die Protagonistin aus Maja Haderlaps jüngstem Roman, macht von dieser Möglichkeit ausgiebigen Gebrauch. Der Besuch der Tochter bei ihrer Mutter Anni, die vor der Delogierung durch den eigenen Neffen steht, gerät zu einem epischen Lamento über die eigenen Verfehlungen, seien diese real oder fantasiert. Mira scheint geradezu erpicht darauf, Schuld zu tragen: am Unfalltod ihres Vaters; am Verrat ihres Herkunftsmilieus durch die Flucht aus der Kärntner Provinz und das Soziologiestudium in Wien; am Desinteresse der Verwandten in Jugoslawien; daran, "dass sie die Entfremdung zur slowenischen Literatur vornehmlich allein betrieben hatte".
Mit "Nachtfrauen" knüpft die Autorin an ihr Romandebüt "Engel des Vergessens" (2011) an, das ihr eine ganze Reihe von Auszeichnungen eingetragen hat, darunter den Bachmann-Preis und den Rauriser Literaturpreis. Der geografische und historische Raum ist der gleiche geblieben, wobei die entsprechenden Orte in "Nachtfrauen" Eisenmarkt und Jaundorf statt Bad Eisenkappel und Jaunstein heißen. Der Fokus aber hat sich von der Vaterfigur auf die der tief religiösen Mutter verlagert, aus deren Perspektive das letzte Drittel des Romans erzählt ist und die sich dem Bedürfnis nach emotionaler Nähe so wenig zu überlassen vermag wie die Tochter: "Gelang es einem doch, im richtigen Moment etwas zu sagen oder gar seine Zuneigung auszudrücken, war man stets peinlich berührt. Erst später, im Nachsinnen, ließ man die herzwarmen Worte an sich heran und kostete etwas von der vermeintlich unverdienten Süße, [ ] um sie gleich wieder abzuwehren."
Das über drei Frauengenerationen verhängte Verhängnis von Verdrängung, Verschweigen und Versagen (im doppelten Sinne des Wortes) lastet allerdings nicht nur auf den Figuren, sondern auf dem ganzen Roman. Mit seiner Detailversessenheit und Beschreibungsfreudigkeit, seinen ineinandergeschachtelten Rückblenden und den in blassgrünen Flügelmappen, rostroten Schulheften und hellbraunen Pappschachteln verwahrten Erinnerungen erreicht er Dimensionen der Gemächlich-und Behäbigkeit, die Adalbert Stifter als narrativen Formel-1-Piloten erscheinen lassen.
Buchstäblich bodenlos aber wird es, sobald die Somatik der angststörungsgeplagten Tochter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt: "Die Ereignisse des Tages drängten gegen die Schädelknochen, als suchten sie nach einem Schlupfloch. Miras Muskeln verhärteten sich, sie glaubte zusehen zu können, wie sie Faser für Faser verholzten. [] Ein mächtiges Gerüst senkte sich auf sie herab, sank geräuschlos und mühelos in ihren Brustkorb ein, der sich in die Tiefe weitete. Geht das endlos so weiter, dachte sie, warum zeigt sich die Bodenlosigkeit gerade dann, wenn man sie am wenigsten braucht." Exakt den entgegengesetzten Weg beschreitet Wolf Haas. Ganz gemäß der Maxime "Lass weg, Haas", die der Autor - Achtung, Kalaueralarm! - in Las Vegas von einem herbeihalluzinierten Ernst Jandl empfangen haben will, setzt sein 150 Seiten schlanker Roman "Eigentum" strikt auf Reduktion und Tempo. Im Alter von 95 trägt die Mutter dem Sohn auf, er möge ihre Eltern anrufen und diesen ausrichten, dass es ihr gutgehe. Drei Tage später ist sie tot. Unmittelbar danach macht sich der Sohn daran, ihr Leben "nachzustricken":"Bis zum Begräbnis bin ich fertig, und dann bin ich es los, die Erinnerung und alles. Ein schneller Text. Und weg damit."
Der bis zur Pietätlosigkeit gehende Mangel an Sentiment ist das intendierte Ergebnis dieser Methode. Der Sohn hat keinerlei Skrupel, seine Niedergeschlagenheit als "faule Ausrede" zu nutzen, um seine Poetikvorlesung abzublasen, gesteht aber zugleich: "Ich war nicht traurig, dass sie gestorben war. Im Gegenteil, ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben glauben, dass es ihr gut ging."
Das Setting von "Eigentum" ist das bereits bekannte: Der diesfalls männliche und mit Klarnamen ausgewiesene Protagonist kehrt in die diesfalls im Pinzgau situierte Provinz seiner Kindheit zurück und nimmt das zum Anlass, die bio-und topografischen Stationen seiner Mutter Revue passieren zu lassen, wobei der Kampf um Wohnraum und der zum Scheitern verurteilte Versuch, Eigentum zu erwerben, zum roten Faden des Romans wird.
Nach den Schweizer Lehrjahren im Gastgewerbe bekommt die Mutter eineinhalb Zimmer im ewig unfertigen Haus der Eltern, wird dort aber vom eigenen Bruder rausgeschmissen. Danach bezieht sie eine frei gewordene Dienstwohnung in einem Gebäude, das gleichsam die Essenz des Dorfes darstellt: "Es beherbergte neben Post, Polizei und Feuerwehr auch die Raiffeisenkasse und das dazugehörige Lagerhaus." Aus Spekulationsgründen delogiert wird die Mutter im Altersheim untergebracht, danach kommt nur noch der Friedhof, mit dem der Autor dank des Ausblicks aus seinem Zimmer seit seiner Kindheit bestens vertraut ist. "Eine platzsparende Feuerbestattung kam nicht in Frage. Unsere Mutter, die ihr Leben lang auf den ersten Quadratmeter hingespart hatte, sollte ihr schlussendlich auf immerhin 1,7 Quadratmeter angewachsenes Grundstück voll ausnützen. Die 1,7 Quadratmeter in bester Lage standen ihr zu, platzsparende Konzepte sollten andere umsetzen."
Wolf Haas hat seinen Handke und seinen Bernhard gelesen, er weiß, dass der reflexionslose Rückgriff auf die Erzählmuster des 19. Jahrhunderts nicht mehr möglich ist. Das Leben des Vaters der Mutter, eines Wagnermeisters, wird entsprechend schnoddrig wie folgt referiert: "Hunger, Kälte, Not, vorübergehende Unterkünfte, notdürftige Baracken und Unterschlupfe, nicht bezahlende Bauern, das ganze Heimatromanelend."
Mit staubtrockener Lakonie, aber auch ausschweifenden Albernheiten -etwa wenn die Lyrics des mexikanischen Schmachtfetzens "Bésame mucho" zu "Bist bes auf mi, Mutti?" umgedichtet werden -gelingt es Haas, mit entschiedenem Strich das Leben einer "schwierigen" Frau zu skizzieren, und gewinnt der Renitenz dieser "spinnerten Alten" einnehmende Facetten ab. Man mag das goutieren oder nicht, die Latte für das Genre Mutter-Roman hat der Autor aber allemal wieder höher gelegt.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: