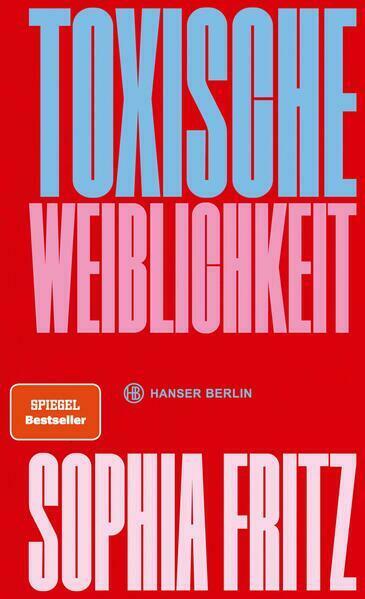Was, wenn es auch toxische Weiblichkeit gibt?
Gerlinde Pölsler in FALTER 14/2024 vom 03.04.2024 (S. 19)
Sophia Fritz, 27, Autorin, Sterbebegleiterin und Tantra-Masseurin, spürt, dass etwas falsch läuft. Wenn sie lächelt, obwohl sie eigentlich streiten möchte. Wenn sie unehrlich zu Freundinnen ist, um Konflikte zu vermeiden. Wenn sie sich für Feminismus starkmacht, aber bei anderen Frauen nach Fehlern sucht. Nach der ersten Wut auf den Begriff "Toxische Weiblichkeit" stellt Fritz fest: Das ist wohl damit gemeint, und es betrifft auch mich.
Toxische Männlichkeit kennen wir inzwischen; aber natürlich fördere das Patriarchat auch bei Mädchen und Frauen Verhaltensweisen, die ihnen selbst und anderen schaden, so die Autorin. Nicht ohne zu betonen: "Toxische Weiblichkeit ist nicht tödlich und sie gilt nicht dem Erhalt einer Machtposition." Was Fritz anstrebt, ist Selbstkritik zwecks Selbstbefreiung. "Toxizität, im Sinne von Destruktivität, gibt es ja in allen Beziehungen. Das Gegenteil von toxisch ist aber nicht heil oder rein, sondern ehrlich." Dazu analysiert sie die fünf Stereotype gutes Mädchen, Powerfrau, Opfer, Mutti und Bitch: Was davon ist bloß misogyne Abwertung -etwa "Bitch" für eine zielstrebige, durchsetzungsstarke und sexuell selbstbestimmte Frau -, und wo gibt es einen wahren, toxischen Kern?
Eine der großen Stärken des Buches liegt in der schonungslosen Selbstanalyse der Autorin. Das "gute Mädchen" etwa erkennt sie stark in sich selbst: empathisch, freundlich, unkompliziert; prinzipiell positive Eigenschaften, gingen sie nicht bis zur (Selbst-)Entfremdung und Unehrlichkeit.
Attribute, die Frauen oft vorgeworfen werden, aber wenig überraschend seien - werden weibliche Menschen doch seit Jahrtausenden unsichtbar gemacht. "Der Großteil der Frauen nimmt immer noch den Nachnamen des Ehemannes an, [] wird nach Diagnosekriterien untersucht, die auf Männer ausgerichtet sind, fährt Autos, deren Crashtests ausschließlich mit Dummies in Männergröße durchgeführt wurden."
Was Frauen brauchen oder wollen, ist also immer noch zweitrangig. Wer ihnen daher vorwirft, dass sie nicht lauter für ihre Rechte aufstehen, sagt Fritz zu Recht, ignoriere "die Realität einer tiefen Prägung, die uns antrainiert hat, dass wir nur dann sicher sind, wenn wir unsichtbar bleiben".
Während es bei Männern immer einen Platz für den einsamen Kämpfer oder das schwierige Genie gab, wurde und wird die auffällige Frau bestraft. Deutlich zu beobachten ist das in Online-Foren: Jede Frau, die sich in die öffentliche Sichtbarkeit wagt, muss damit rechnen, beschämt, heim an den Herd geschickt oder sexuell bedroht zu werden.
Als sexistisch entlarvt Fritz auch den Begriff "Powerfrau": Impliziert er doch, eine Frau mit Power sei die Ausnahme, und facht damit die Konkurrenz unter Frauen an. Am strengsten verfährt die Autorin mit der "Mutti". Einerseits schreibt sie über die Einsamkeit der Mütter, über denen von Tag eins an die Drohung schwebt, eine schlechte Mutter zu sein. "Mutti" muss ja noch immer als Schuldige für Verkorkstheiten jedweder Art herhalten.
Gleichzeitig tappt die Autorin selbst in die Falle, wenn sie den Müttern ihrer Generation "Leere" vorwirft und die (abwesenden) Väter außen vor lässt.
Doch es wäre nicht Fritz, folgte die Selbstreflexion nicht auf dem Fuße. "Während ich das schreibe, bemerke ich einmal mehr meine eigene misogyne Prägung": Gegenüber Müttern "beinahe erbarmungslos [ ], während ich den Vätern augenzwinkernd verzeihe [ ] Wie bitter." Ein Satz wie so viele in diesem aufwühlenden Buch: hart, wahr -und bitter nötig.