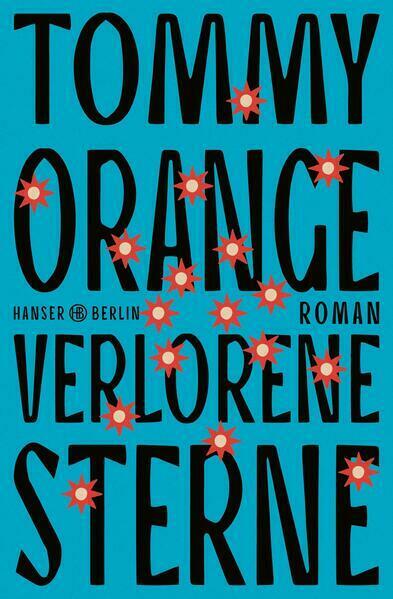Viel getrommelt und getanzt
Sigrid Löffler in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 22)
Er gilt als die kraftvolle neue Stimme der nordamerikanischen Ureinwohner: Tommy Orange, Jahrgang 1982, ein Native American vom Stamm der Cheyenne und Arapaho. In seinen beiden Romanen „Dort, dort“ und „Verlorene Sterne“ rückt er ein gerne verdrängtes Thema neu ins Bewusstsein – den Vernichtungskrieg, den die europäischen Einwanderer gegen die Ureinwohner führten.
Beide Romane beginnen mit einem sarkastischen Schnelldurchgang durch die Leidensgeschichte der American Indians in ihrem vergeblichen Kampf gegen die Kolonisatoren – von der Vertreibung aus ihren angestammten Territorien über die Massaker an den rebellischen Stämmen der Prärie-Indianer bis zur erzwungenen Assimilation, die die Ureinwohner vor das Dilemma stellten, entweder in der überlegenen Zivilisation auf- oder unterzugehen.
„Dieser Krieg hat länger angehalten, als es die USA heute gibt. Dreihundertdreizehn Jahre. Und nach all dem Töten und Vertreiben und Versprengen und Wieder-Zusammentreiben von Indianern, um sie in Reservate zu sperren, und nachdem die Bison-Population von rund dreißig Millionen auf ein paar Hundert Wildtiere zusammengeschossen war, schließlich bedeutete ,jeder tote Bison einen Indianer weniger‘, kam ein neuer politischer Slogan für das Indianerproblem auf: ,Den Indianer töten, um den Menschen zu retten‘. Als die Indianerkriege langsam abkühlten, als Landraub und Selbstverwaltung der Stämme zu bloßer Bürokratie wurden, steckte man die Indianerkinder in Internate, wo man ihnen beibrachte, was alles am Indianer-Sein falsch war. Damit aus ihm ein Nicht-Indianer im Sinne dieser Schulen wurde, tötete man den Indianer, um den Menschen zu retten.“
Das Augenmerk des Autors gilt vor allem jener Generation von Urban Indians, die in den letzten 50 Jahren das elende Dasein in den Indianerreservaten aufgaben, um in den Städten Arbeit und ein besseres Leben zu suchen. Konkret erzählt Tommy Orange von der schwierigen Existenz einer Handvoll städtischer Indianer und deren Familien in seiner Heimatstadt Oakland, Kalifornien.
Sie sind gezwungen, ihr Dasein auf und in dem Land zu fristen, das ihnen weggenommen wurde, und sie kämpfen nicht nur gegen Armut und Arbeitslosigkeit. Fast alle Romanfiguren sind und waren eine Zeit lang suchtkrank, abhängig von Nikotin, Alkohol oder anderen Drogen. Die Familien sind zerstückelt, die Männer hauen irgendwann ab und überlassen es den Frauen, sich und die Kinder durchzubringen und so etwas wie ein Familienleben zu improvisieren. In beiden Romanen spielt der Teenager Orvil Red Feather eine Protagonistenrolle, neben den beiden taffen Halbschwestern Opal Bear Shield und Jacquie Red Feather, die als Erzieherinnen des Schulabbrechers fungieren.
Beide Romane thematisieren die Zerstörung des historischen Gedächtnisses der Native Americans und deren Versuche, dieses wieder zu restituieren, die verlorenen Stammessprachen, Zeremonien, Tänze und Gesänge wiederzubeleben; allerdings immer in dem Bewusstsein, selbst gar keine „echten“ Indianer mehr zu sein. Sie veranstalten sogenannte „Powwows“, Traditions- und Brauchtumstreffen, auf denen viel getrommelt und getanzt wird, und wissen doch, dass sie sich bloß für ein Folklore-Event verkleidet haben: „Kein Indianer von damals, als die Weißen uns das erste Mal so genannt haben, würde uns heute noch als Indianer erkennen. So hätten sie sich selber überhaupt nicht genannt. Sie hatten ja ihre eigenen Sprachen und Namen für alles. Genau wie sie ja auch in Afrika alle ihre verschiedenen Länder mit eigener Geschichte haben und doch alle Afrikaner sind.“
Bereits mit seinem vor sechs Jahren erschienenen preisgekrönten Debütroman „Dort, dort“ hatte Tommy Orange international Eindruck gemacht. Er erzählte darin vom Aufstand der Urban Indians Kaliforniens gegen ihre Entrechtung und Entterritorialisierung, der 1969 in der historischen Besetzung der ehemaligen Gefängnisinsel Alcatraz gipfelt, an der der Autor etliche seiner Figuren teilnehmen lässt. Im Finale des Romans treffen sich alle bei einem Powwow in Oakland, bei dem es zu einer Schießerei mit vielen Toten und Verletzten kommt. Dabei wird der Teenager Orvil Red Feather angeschossen und schwer verwundet.
In „Verlorene Sterne“, seinem neuen Roman, erzählt Orange mehr über Orvils Herkunft und darüber, wie es mit dem Jungen nach dem Powwow-Anschlag weiterging. Erzählt wird im Wesentlichen Orvils Suchtgeschichte, die den vorhersehbaren Verlauf nimmt. Es beginnt damit, dass dem Jungen, der einen Steckschuss abbekommen hat, gegen die Schmerzen viel zu starke Morphiumtabletten verschrieben werden. Bald erhöht er eigenmächtig die Dosis: „Ihm kam der Gedanke, dass er süchtig wurde. Das Wort war ihm nicht fremd. Diesen Vorwurf hatte er schon in Bezug auf Videospiele und sein Handy und Bildschirme im Allgemeinen gehört. Und er wusste, dass er von Süchtigen abstammte. In seinem Fall war ihm schon vor seiner Geburt die Sucht eingestochen worden. Von seiner Mom mit Nadel und Heroin.“ Ein Schulkamerad gewöhnt ihn an Tabletten, die sein Vater zuhause in einem Privatlabor herstellt. Um seine Sucht zu bedienen, wird Orvil selbst zum Dealer. Am Ende stehen eine Überdosis und ein qualvoller Entzug.
Der Gefahr des Elendskitschs, zu dem eine solche Geschichte leicht verkommen könnte, entgeht Tommy Orange durch den abgebrüht-coolen Erzählton, den er anschlägt. Schon sein Rückblick auf die Leidensgeschichte der indianischen Völker vermied alle Weheleid- und Klage-Rhetorik, sondern behandelte die historische Katastrophe mit bissigem Ingrimm. Lässiger ist dieser pathos-gefährdete Stoff noch nie erzählt worden.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: