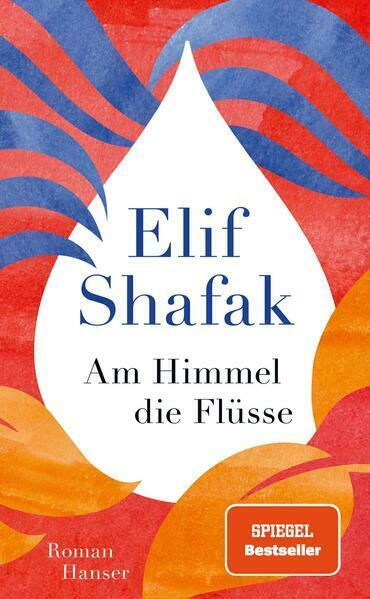Der Tropfen in Themse und Tigris
Jörg Magenau in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 20)
In einem Wassertropfen steckt bekanntlich ein ganzes Universum. Bei Elif Shafak steckt in einem Wassertropfen ein ganzer Roman. Wasser, heißt es da, „erinnert sich“. Es ist „die seltsamste Chemikalie, das größte Rätsel“. In einer Art Prolog wird ein Regentropfen, der im 7. Jahrhundert vor Christus auf die Stirn des babylonischen Herrschers Assurbanipal fällt, zum Zeugen einer schrecklichen Tat: Der König, so gebildet wie blutrünstig, lässt seinen alten Lehrer bei lebendigem Leib verbrennen. Assurbanipal steht in seiner Bibliothek aus Tontafeln. Von hier stammen die Keilschrift-Fragmente, die Jahrtausende überdauerten und die das Gilgamesch-Epos bewahrt haben.
Diesen Fundstücken gilt die Leidenschaft der Romanfigur Arthur Smyth, die auf einem realen historischen Vorbild beruht: dem Entzifferer der Keilschrift George Smith, der sein ganzes Leben dem Gilgamesch Epos und der Entzifferung der Keilschrift widmete.
Als Arthur im Jahr 1840 am Ufer der Themse im Schlamm und in entsetzlicher Armut geboren wird, landet eine Schneeflocke auf seiner Zunge. Es ist eben der Wassertropfen, der in Babylon auf die Stirn des Tyrannen fiel. Vielleicht ist Arthur wegen dieser Berührung mit einem außerordentlich präzisen Gedächtnis ausgestattet, weil Wasser Erinnerungen in homöopathischer Dosis enthält.
Die Anordnung des Wassermoleküls war auch Inspiration für die Struktur des Romans. So wie ein Sauerstoffatom von zwei Wasserstoffatomen umrahmt wird, so fügt Shafak ihre Handlungen zusammen. Die Arthur-Geschichte steht als O in der Mitte. Die Passagen über seine Kindheit in den Elendsquartieren Londons lesen sich wie ein Roman von Charles Dickens, dem Shafak sogar einen eigenen Auftritt ermöglicht.
Flankiert wird dieser Erzählstrang von den beiden H-Teilen. Das ist zunächst einmal die Geschichte des Jesiden-Mädchens Narin, das im Jahr 2014 am Tigris getauft werden soll, deshalb mit der Großmutter aus der Türkei in den Irak aufbricht und dort in ein Massaker des „Islamischen Staates“ gerät. Diese dramatische Reise hat auch mit einem Staudammbau im südlichen Anatolien zu tun, der dazu geführt hat, dass Ausgrabungsstätten und uralte Kulturgüter in den Fluten des Tigris versunken sind.
Im anderen H-Teil geht es um die Hydrologin Zaleekhah, die 2018 in einem Bootshaus auf der Themse lebt. Ihre Depressionen verdankt sie einem Kindheitstrauma: Sie verlor ihre Eltern bei einem Hochwasser des Tigris und wuchs danach bei einem schwerreichen Onkel in London auf. Wasser will sie deshalb erforschen, weil sie darin ihr eigenes Schicksal gespiegelt sieht: „Wasser ist durch und durch Immigrant, es ist gefangen im Übergang und kann sich nirgends für immer niederlassen.“
Elif Shafak lebt mit ihrer Familie in England und schreibt auf Englisch, doch ihr Thema bleibt die türkische Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Roman „Der Bastard von Istanbul“, der sich mit dem Völkermord an den Armeniern auseinandersetzt, trug ihr eine Anklage wegen „Beleidigung des Türkentums“ ein.
Ihr jüngstes Buch, „Am Himmel die Flüsse“, verhandelt am Beispiel von Narin die jahrhundertelange Unterdrückung und Verfolgung der Jesiden. Die Angehörigen dieser uralten, nur mündlich tradierten Religion galten als Ungläubige, als „Teufelsanbeter“.
Darüber hinaus beschreibt Shafak, wie Kunstgegenstände aus der mesopotamischen Zeit in alle Welt verhökert wurden. Sie skandalisiert den Bau des international höchst umstrittenen Ilisu-Staudamms, für den 80.000 Menschen – darunter viele Jesiden – umgesiedelt werden mussten. In diesem Fall ist das Wasser nicht nur Symbol, sondern die ganz handfeste Ursache von Heimatlosigkeit. Dass am Ende auch noch illegaler Organhandel thematisiert wird, ist dann fast ein bisschen zu viel für diesen überquellenden Roman.
Miteinander verbunden sind die verschiedenen Orte und Zeiten zunächst nur durch den Wassertropfen auf seinem ewigen Kreislauf durch die Atmosphäre. Mal stammt er aus einem verunreinigten Brunnen und bringt die Cholera nach London; mal taucht er als Träne auf der Wange der Hydrologin auf; dann befindet er sich in der Flasche mit Tigriswasser, mit dem Narin getauft werden soll. Erst ganz am Ende führt Shafak die drei Handlungsstränge mit einer überraschenden Volte dann tatsächlich zusammen, nachdem auch die Hydrologin Zaleekhah in humanistischer Mission zum Tigris aufbricht.
Alles fließt, das Strömen von Themse und Tigris wird zur Metapher für das Erzählen selbst, das wie das Wasser alles in sich aufzunehmen vermag. Gelegentlich spürt man den Druck, unter dem die Autorin stand, auch noch diese und jene Fakten unterzubringen. Das staut gelegentlich den Erzählfluss, zumal die Informationen über das Gilgamesch-Epos nicht unbedingt dem Wissensstand von 1870 entsprechen.
Shafak ist eine epische Erzählerin, detailreich und lebensnah. Wunderbar sind die archaischen Mythen, die Narins Großmutter immer wieder erzählt. Die Uhrzeit, heißt es da, sei verzerrt und trügerisch. Anders ist es mit der „Zeit in den Geschichten“. Sie weiß um „die Brüchigkeit des Friedens, die Tücke der Lebensumstände, die nächtlich lauernden Gefahren, aber sie würdigt auch die kleinen liebenswürdigen Gesten. Deshalb leben Minderheiten nie in der Uhrzeit. Sie leben in der Geschichtenzeit.“ Genau aus diesem Grund ist Elif Shafak eine Erzählerin, für die Zeitgeschichte nicht linear abläuft, sondern in all ihren Episoden ineinanderfließt. Alles hat mit allem zu tun, quer durch die Zeiten, vom Altertum bis in die unmittelbare Gegenwart.