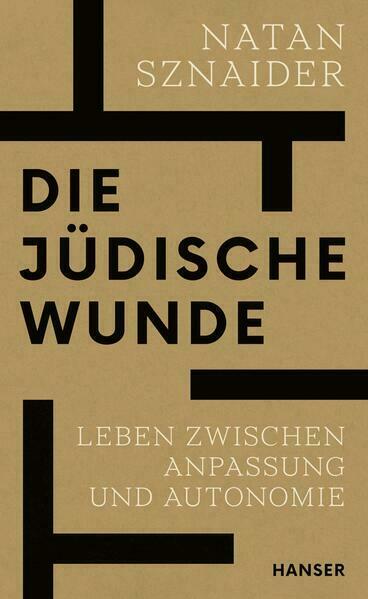Die jüdische Wunde schmerzt in Deutschland und in Israel weiter
Tessa Szyszkowitz in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 31)
Natan Sznaider, in Deutschland geborener israelischer Soziologe, begibt sich mit einem anderen Nathan auf eine Zeitreise durch die jüdische Existenz in Israel und der Diaspora. Nathan der Weise steht, seit Gotthold Ephraim Lessing die fiktive Figur 1779 geschaffen hat, für Aufklärung und Toleranz. Der Versuch der aufgeklärten Juden, in Europa akzeptiert zu werden, bedeutet aber dann im 19. Jahrhundert vor allem eines: „Die Idee der Aufklärung heißt nicht mehr jüdische Selbstbestimmung, sondern von der nichtjüdischen Umwelt toleriert oder geduldet zu werden“, schreibt Sznaider. „Die Aufklärung war die Geburtsstunde des ,unsichtbaren‘ Juden.“ Er untermauert das mit Karl Marx’ Schrift „Zur Judenfrage“ aus dem Jahr 1843 über die politische Emanzipation der Juden und warum sie scheitern musste. Marx schreibt: „Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum.“
Diese Aussage wurde nicht nur von den Feinden der Juden gerne zitiert. Für jene Juden, die sich im Sozialismus wiederfanden, war es ein Versprechen, als Menschen gleichberechtigt in einer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft leben zu können. Mit dem Holocaust endete diese Illusion. Doch es gibt, so absurd das 1945 schien, natürlich doch ein Leben nach dem Tod der deutsch-jüdischen Beziehungen. Das deutsche Theater wird 1945 wieder mit Lessings „Nathan der Weise“ eröffnet. „Es ist das passende Ideendrama für das zerstörte Berlin im Herbst 1945: philosophische Toleranz und ein Jude, der sich für sie hingibt“, schreibt Sznaider. 1958 bekommt die in Deutschland geborene Philosophin Hannah Arendt, die vor den Nazis nach New York geflohen war, vom Hamburger Senat den Lessingpreis verliehen – in der Hoffnung, „die deutsch-jüdische Tradition könne die Barbarei überwinden“.
Gustav Gründgens, die Manns, Mascha Kaléko – Sznaider führt uns sehr detailliert durch die deutsch-jüdische Debatte nach 1945 und die Frage, wie ein Zusammenleben möglich sein kann. Der Soziologe zieht dann eine Linie bis heute und zur Debatte um das Wimmelbild von Taring Padi auf der documenta 15 vor zwei Jahren. Das Bild wird schnell wieder abgebaut, die Darstellung eines an einen orthodoxen Juden erinnernden Mannes mit SS-Runen im Hut stößt ab, erschreckt und empört viele. „Je häufiger beteuert wird, dass es für Antisemitismus im öffentlichen Raum in Deutschland keinen Platz gibt, desto stärker wird man sich der Anwesenheit des Antisemitismus im öffentlichen Raum bewusst.“
Von der Kolonialismusdiskussion, die rund um die documenta entbrennt, ist es nur noch ein kleiner Schritt nach Israel. „Israel stammt aus Europa, liegt aber nicht in Europa. Israel kann daher als eine weiße europäische Formation betrachtet werden, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum eroberte“, schreibt Sznaider.
Schon am Anfang dieser in jeder Hinsicht atemberaubenden Studie über die jüdische Existenz in Diaspora und Israel hat er konstatiert: „Die israelische Souveränität verändert den jüdischen Blick. Juden sind nicht mehr Fremde und Marginalisierte, sondern verfügen als souveräne Subjekte über Macht.“ Der Vertrag zwischen dem modernen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern lautete, dass Israel für die Sicherheit garantierte. Der 7. Oktober aber habe alles verändert. Der Vertrag wurde gebrochen, die Zivilbevölkerung hilflos der Hassorgie der Hamas ausgesetzt.
„Es ist der zionistische Fehlschluss, der annahm, dass Israel ein Staat wie jeder andere sein könne, wo das Jüdische unsichtbar wird“, schreibt Sznaider. Er lässt aber offen, wohin diese Erkenntnis führt. Sein Alter Ego Nathan geht zurück ins Haus und macht die Tür hinter sich zu.