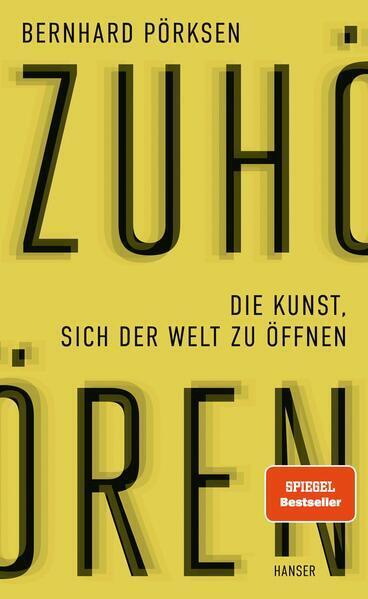"Wer will schon Digital-Detox-Spießer sein?"
Tessa Szyszkowitz in FALTER 15/2025 vom 09.04.2025 (S. 26)
Professor Pörksen erscheint pünktlich zum Interview im Videolink. Er hat sich Zeit genommen. Zeit, die er vielleicht gar nicht hat. Bei ihm stapeln sich Interviewanfragen. Der Medienwissenschaftler kommt gerade von der Leipziger Buchmesse, jetzt geht die Lesereise mit seinem jüngsten Buch gleich weiter: "Zuhören" heißt es. Es trifft offenbar einen Nerv in einer Gesellschaft, die erschöpft von der Dauerbeschallung schreit: "Ich kann es nicht mehr hören." In Wirklichkeit, konstatiert Pörksen, ist es eher so: Die Menschen können einander nicht mehr zuhören.
Wir sollten eben lieber manchmal dem Clown glauben. Welchem Clown? Dem Spaßmacher aus dem Gleichnis des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Der Clown warnt Dorfbewohner vor einem Feuer, aber sie hören ihm nicht richtig zu, sie glauben ihm nicht, weil sie wegen seiner Aufmachung von ihm eben nur einen Scherz erwarten. Je mehr er bettelt und fleht und schreit, dass sie endlich verstehen sollten, dass er es ernst meint und sie löschen kommen müssen, umso mehr lachen sich die Dorfbewohner kaputt.
Bernhard Pörksen erzählt diese Geschichte im Vorwort. Er hat ausdrücklich kein Handbuch mit Tipps geschrieben, er will keine Handlungsanleitung geben, wie Menschen wieder besser kommunizieren. Er möchte aber mit emotional erzählten Beispielen eine Verbindung erzeugen, die seine Leserschaft dazu anregt, es vielleicht doch noch einmal mit diesem altmodisch anmutenden Gut zu versuchen: aufeinander einzugehen. Es wird ein langes Falter-Gespräch, von dem wir hier eine gekürzte Version bringen. Im Falter-Podcast können Sie das ganze Interview genießen. Natürlich nur, wenn Sie zuhören wollen.
Falter: Herr Pörksen, wir möchten Ihnen heute gerne so richtig zuhören. Bernhard Pörksen: Da freue ich mich.
Vor 100 Jahren hatten meine Großeltern einen Radioapparat, den sie abends aufdrehten, um zu wissen, was los war in der Welt. Heute werden wir ständig aus den unterschiedlichsten Kanälen beschallt. Wie soll man da überhaupt noch richtig zuhören?
Pörksen: Das ist in der Tat schwer, gerade weil wir Menschen ohnehin keine guten Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Wir leben sehr oft im eigenen Film, im System unserer eigenen Urteile und Vorurteile. Und wir erleben eine laufende Medienrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder mit der Erfindung des Buchdrucks. Früher war Information knapp, heute ist Aufmerksamkeit knapp. Früher war es schwer, zu senden, heute schwer, Gehör zu finden. Das verändert das Zuhören massiv.
Wir schieben das gerne auf die sozialen Medien, ist das gerecht?
Pörksen: Im Silicon Valley arbeiten einige der intelligentesten Menschen daran, die Programmierung der Ungeduld voranzutreiben -durch die Dauerunterbrechung, die Ablenkung, die Fragmentierung von Aufmerksamkeit. Ziel ist es, uns am Bildschirm zu halten, um dann unsere Datenprofile auszuspionieren und sie meistbietend an die Werbeindustrie zu verkaufen. Wir wissen, ein X-Posting wird um den Faktor 50 häufiger verbreitet, wenn es um empörende, aufwühlende Inhalte geht. Erneut: All dies verändert das Zuhören in der Tiefe, macht das Zuhören gerade in diesen so gereizten Zeiten so besonders schwer.
Das klingt, als würden Sie mit der Schriftstellerin Eva Menasse übereinstimmen, die sagt, die öffentliche Kommunikation liege in Trümmern. In Ihrem Buch nennen Sie das auch "Diskursalarmismus".
Pörksen: Ich sage das mit allem Respekt vor dem Werk von Eva Menasse, vor ihren so bereichernden, das Denken erweiternden Interventionen: Aber ich halte nichts von der Idee, dass der Diskurs vollkommen in Trümmern liegt, dass wir uns in Richtung eines postfaktischen, nur noch von Irrationalität und Erregungsstichflammen geprägten Spektakels bewegen. Ein solcher Pessimismus ist reine Zeitverschwendung. Wir leben, kommunikationsanalytisch betrachtet, in mindestens drei Welten. Ja, es gibt die Welt von Hass und Hetze, von Verpöbelung und verbaler Gewalt. Und wir müssen als offene Gesellschaft Mittel und Wege finden, um dagegen vorzugehen. Es gibt aber auch eine Welt der manchmal hypersensiblen Verspanntheit, des betulichen, überkorrekten Sprechens. Und es gibt schließlich eine Welt des authentischen Respekts, des wirklichen Austausches, des tatsächlich Miteinanderredens und Einanderzuhörens. Egal, ob in Schulen, Universitäten, Redaktionen oder einfach auch am Familientisch.
Die erste Welt, die von Erregungsstichflammen auf Online-Plattformen gekennzeichnet ist, dominiert aber den politischen Diskurs. Ich kenne inzwischen viele Leute, die einfach gar keine Nachrichten mehr hören wollen. Würden Sie sich gegen diesen Trend aussprechen?
Pörksen: Ja, das würde ich. Aber den Impuls kann ich durchaus verstehen. Es ist entsetzlich, die Bilder aus Israel und Gaza zu sehen, die Bilder von verheerenden Bränden in Kalifornien, von Ertrinkenden im Mittelmeer. Plötzlich ist da nur noch Ohnmacht. Und manchmal scheint es, als würden einen diese Bilder in einen Voyeur oder in einen Zyniker verwandeln, der fasziniert oder gleichgültig auf das Elend blickt. Was also tun? Aus meiner Sicht braucht es einen individuell zu entdeckenden Balanceakt zwischen selbstfürsorglicher Abgrenzung und engagierter Weltzuwendung. Denn sonst droht entweder die Dauerverstörung im Nachrichtengestöber oder ein Digital-Detox-Spießertum, das nur noch den Krümmungswinkel des eigenen Bauchnabels analysiert und den eigenen Seelenfrieden heiligspricht; auch das wäre der Dramatik der Zeit nicht angemessen.
Dabei wollte die erste Generation der Interneterfinder vor einem halben Jahrhundert eigentlich eine demokratische Kommunikationsform erfinden?
Pörksen: Ja, die ersten Online-Gemeinschaften im Silicon Valley wollten nicht primär Geld verdienen. Visionäre wie Stewart Brand waren Kinder der 1960er-Jahre, der Flowerpower-Revolution, geprägt von Kommune-und LSD-Erfahrungen, von ihren Utopien, dem Ideal der Weltverbesserung.
Hätten sie es besser wissen sollen? Pörksen: Ich weiß es nicht. Entscheidend scheint mir: Die Computerhippies der ersten Stunde dachten in der Kategorie des Wir. Und die heutigen Libertären denken vor allem in Kategorien der Singularität: ich, ich, ich. Mit Elon Musk und Peter Thiel, Zentralfiguren der sogenannten PayPal-Mafia, sehen wir eine Generation, die sich dem "anti-woken" Kulturkampf verschrieben hat, die sehr strategisch vorgeht, die jede Form von Regulierung eigentlich als Widerstand interpretiert und zur Seite wischen möchte. Und die in nie gekannter Schamlosigkeit politische, ökonomische und medial-digitale Macht besitzt. Das ist der große Bruch, der entscheidende Unterschied.
Ich habe mich vor kurzem im Museum für Computer Science in Mountain View in Kalifornien sehr angeregt mit einer Robot-Frau namens Ameca unterhalten. Und zwar darüber, ob sie etwas Kritisches über Donald Trump sagen darf. Sie war ganz locker und hat gerne kritische Sachen über Trump gesagt. Sie hat mir aber auch Gegenfragen gestellt. Und am Ende fragte ich mich: Hört sie mir zu oder horcht sie mich aus? Pörksen: Hochinteressant. Und man sieht: Maschinen zwingen uns zu anthropologischen Reflexionen. Was ist das Wesen des Menschen, was ist das Wesen von Begegnung, was ist das Wesen des Zuhörens? Werden Sie verstanden oder ausgetrickst? Mein Punkt: Die gegenwärtige KI-und Computerwelt ist ein riesenhaftes Reflexionslabyrinth, in dem wir permanent den grundsätzlichsten Fragen begegnen.
Die Frage ist, ob am Ende die Maschinen besser zuhören können als wir. Sie hat vielleicht nicht so ein Bedürfnis, dauernd selbst zu reden. Adam Grant von der University of Pennsylvania sagt: "ChatGPT ist eine bessere Zuhörerin."
Pörksen: Das scheint mir vollkommen unsinnig. Schon die Idee, dass eine Maschine zuhört, ist ein Akt des Anthropomorphismus, ein Akt der Vermenschlichung, der lediglich simuliert, man würde begreifen, was hier passiert. Natürlich kann jemand, der sonst niemanden hat, glücklich sein, dass ihn wenigstens ein Roboter anspricht. Geschenkt. Und doch: Es gibt wahrscheinlich kaum eine größere Sehnsucht als nach dem wirklich Gehört-und Verstandenwerden - von einem echten Menschen, einem wirklichen Gegenüber.
In Ihrem Buch schreiben Sie, den Unterschied beim Zuhören macht aus, ob man mit dem Ich-Ohr oder dem Du-Ohr zuhört. Was ist der Unterschied?
Pörksen: Aus meiner Sicht gibt es ein Ich-Ohr-Zuhören egozentrischer Aufmerksamkeit, geleitet von der Frage: Ist das, was der andere mir gerade gesagt hat, nach meiner Auffassung wahr, stimmt es mit dem überein, was ich selbst denke und glaube? Hier sind also die eigenen Filter außerordentlich dominant. Und man hört im Extremfall vor allem sich selbst, geleitet von der persönlichen Perspektive, den eigenen Überzeugungen.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Pörksen: Ja, es ist die Normalform des Zuhörens, die gängige Praxis. Und auf der anderen Seite, das Du-Ohr-Zuhören der nicht-egozentrischen Aufmerksamkeit, regiert von einer ganz anderen Frage: In welcher Welt ist das, was der andere mir gerade sagt, plausibel, schön? In welcher Welt ist es wahr? Mich interessiert in diesem Buch über diese ganzen 300 Seiten hinweg eigentlich nur eine einzige Frage: Wie gelingt es, vom Ich-Ohr-Zuhören zum Du-Ohr-Zuhören umzuschalten? Wie entsteht geistige Offenheit?
Aber was, wenn man es dann mit Nazis zu tun bekommt, die sich überhaupt nicht mit unseren liberal-demokratischen Anschauungen auseinandersetzen wollen?
Pörksen: Aus meiner Sicht gibt es zwei Pfade des Du-Ohr-Zuhörens. Wir können zuhören, um zu verstehen, um Verständnis für den anderen zu entwickeln und letztlich zu einem Einverständnis zu gelangen. Aber es gibt auch eine andere Art des Du-Ohr-Zuhörens. Da lässt man den anderen kommen, versucht, sich von eigenen Filtern zu lösen, erst einmal anzuhören, was er oder sie sagt. Und am Schluss dieses Prozesses gelangt man dann zu einer gut begründeten, sehr klaren, präzisen Verurteilung.
Sie stellen die These auf, dass Tiefengeschichte unser Zuhören bestimmt, dass unsere emotional eingefärbte Matrix entscheidet, was wir mitnehmen aus einem Gespräch. Ihre These ist also: Wir hören, was wir fühlen?
Pörksen: Ja, unbedingt. Ein Beispiel: Ich habe mich mehr als zehn Jahre mit Menschen ausgetauscht, die mit der Odenwaldschule zu tun hatten. Das war eine berühmte Unesco-Reformschule in einem einsamen Tal bei Frankfurt. Und ein Ort des schrecklichen Missbrauchs, der auf ein absolut merkwürdiges Phänomen in der Skandalgeschichte der Bundesrepublik verweist: wissende Ignoranz; alles ist öffentlich, aber niemand reagiert. 1999 schreibt ein junger Reporter für die Frankfurter Rundschau alles auf ...
Jörg Schindler, damals bei der Frankfurter Rundschau, heute beim Spiegel ...
Pörksen: Genau. Er publiziert die Missbrauchsgeschichte. Und nichts geschieht. Kein Leitmedium greift die Enthüllung auf. Ein paar lokale Reaktionen, mehr nicht. Ein Jahrzehnt später veröffentlicht derselbe Reporter in derselben Zeitung mehr oder minder denselben Artikel mit denselben Informanten und Informationen noch einmal: Missbrauch an der Odenwaldschule. Plötzlich sind überall Fernsehteams im Tal, es gibt Pressekonferenzen, jede Menge Artikel, sämtliche Medien in der Bundesrepublik greifen diese Geschichte auf. Wie kann das sein?
Vielleicht wollten viele den Skandal nicht aufgreifen, weil sie fürchteten, damit die ganze Reformpädagogik zu ruinieren?
Pörksen: Ein Fall von Ich-Ohr-Zuhören, gewiss. Hinzu kommt: Es gab eine absolut wissenschaftsfeindliche, voraufklärerische Heiligenverehrung in der reformpädagogischen Szene. Gerold Becker, der verkrachte Schulleiter und Haupttäter, wurde von manchen als Lichtgestalt verehrt; Hartmut von Hentig, sein Lebensgefährte, meinte noch 2010, vielleicht könne es sein, dass Gerold Becker von ein paar Jungen verführt worden sei -und stellte Becker öffentlich in eine Reihe mit Sokrates und Rousseau. Katastrophale Sätze, die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Hentig selbst wurde nach solchen Äußerungen von dem Bildungsjournalisten Reinhard Kahl noch 2010 in einer pädagogischen Fachzeitschrift mit Christus verglichen -kein Scherz! Man sieht hier: Je intensiver die Verehrung, desto größer die Blindheit.
War es auch eine Generationsfrage? Dass man heute über sexuellen Missbrauch an Schülerinnen und Schülern in Klöstern und Schulen eher sprechen kann?
Pörksen: Ja. Wir wissen inzwischen: Priester und vermeintliche Heiligengestalten der Reformpädagogik sind nicht unfehlbar. Nötig ist aber noch anderes. Zum einen der Langstreckenlauf der Aufklärung durch die Betroffenen. Zum anderen eine mutige Schulleiterin, die in einem sehr entscheidenden Moment zuhört. Der Name dieser Schulleiterin ist Margarita Kaufmann, sie hat eine eigene Tiefengeschichte, sie hat selbst Missbrauch erfahren. Man könnte sagen, dass ihre eigenen Narben fast so etwas sind wie Wahrnehmungsorgane, die sie sensibel werden ließen. Margarita Kaufmann tritt kurz nach dieser zweiten Veröffentlichung 2010 vor die Presse und sagt unter Tränen: Niemand wird der Odenwaldschule diese Schuld wieder nehmen. Und sie bittet gleichzeitig um Verzeihung, wissend, dass die Schwere der Schuld sich nicht auslöschen lässt. Aus der Sicht eines gewieften, glatten PR-Kommunikationsprofis könnte man sagen: Bitte keine Tränen! Aber: Diese Tränen öffnen einen Raum. Sie lassen etwas entstehen, was ich den Dominoeffekt des Zuhörens nenne. Auf einmal entsteht ein geistiges Klima, in dem etwas sagbar wird, was vorher nicht sagbar schien.
Ein anderes Beispiel, an dem Sie erklären, welches immense Problem wir mit dem Zuhören haben, ist die Geschichte von Misha Katsurin. Zu Kriegsbeginn im Februar 2022 ruft er seinen Vater in Russland von Kiew aus an und sagt: Die russische Armee bombardiert uns. Und der Vater glaubt ihm nicht.
Pörksen: Die Geschichte könnte damit zu Ende sein, und sie wäre ein Beispiel für die Macht von Desinformation. Aber Misha Katsurin sagt sich: Nein, das akzeptiere ich nicht. Und entwickelt eine brillante Idee. Elf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Was wäre, wenn sie ihre russischen Verwandten kontaktieren und mit ihnen sprechen, um sie wirklich zu berühren? Und wenn diese dann nur zwei, drei anderen Russinnen und Russen von der Wahrheit des Krieges erzählen? Dann wäre, so denkt sich Misha Katsurin, die Macht der Desinformation irgendwann gebrochen, Schritt für Schritt.
Eine Weile hob das Projekt "Papa, believe." toll ab. Aber inzwischen ist es gescheitert.
Pörksen: Ja, so ist es. Nach dem Massaker von Butscha, der Bombardierung der Geburtsklinik in Mariupol, der verblutenden Schwangeren war alles vorbei. Und doch und ganz persönlich gesagt: Mich selbst hat dieses Engagement von Misha Katsurin, den ich fast drei Jahre begleitet habe, unendlich ermutigt. Es ist der Versuch, um den es geht.
Mein Lieblingszitat aus Ihrem Buch: "Wirkliches Zuhören ist nur in Freiheit denkbar." Denn: "Man kann Menschen zum Schweigen bringen, das ist möglich. Aber man kann sie nicht zum Zuhören zwingen."
Pörksen: Ja. Das Zuhören ist frei. Und die Kunst des Zuhörens ist eine Kunst des Herausfindens. Ein Weg, den jede und jeder für sich beschreiten kann. Das ist doch eigentlich wunderbar, oder?