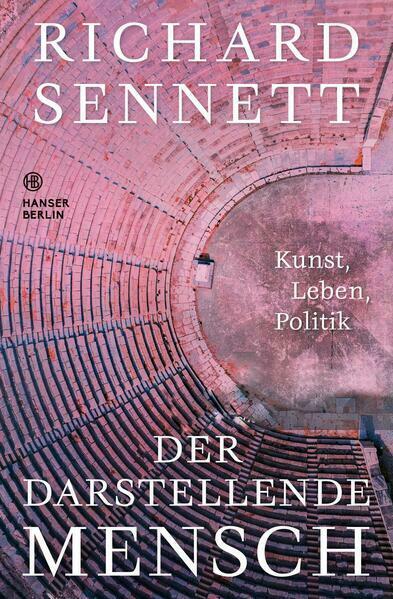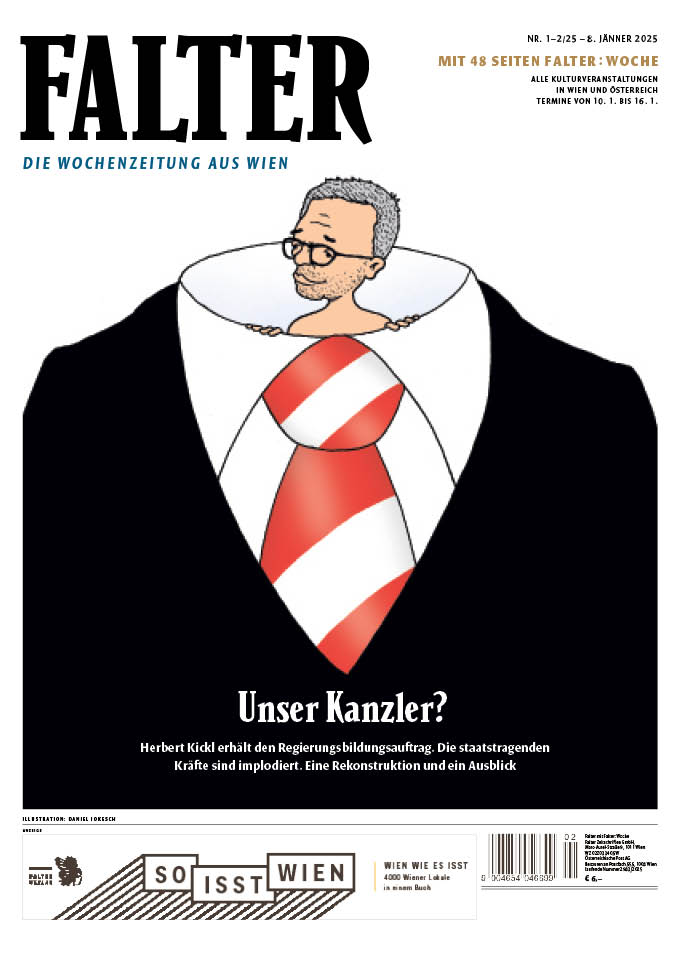
Die Kunst der Selbstdarstellung
Tessa Szyszkowitz in FALTER 1-2/2025 vom 08.01.2025 (S. 19)
Die Schriftstellerin Virginia Woolf hat hier gewohnt. Und Charles Dickens, der Chronist des Viktorianischen Zeitalters. Bloomsbury galt immer schon als eines der intellektuellen Zentren Londons. Um die Ecke des Hausmuseums von Dickens, dem Sozialkritiker und Bestsellerautor seiner Zeit, der wie kein anderer die bittere Armut seiner Heimatstadt im 19. Jahrhundert beschrieben hat, lebt einer, der ebenfalls die Lebensbedingungen der modernen Großstadt analysiert hat.
Richard Sennett, 82, öffnet die Tür im ersten Stock einer dreistöckigen Wohnsiedlung aus den 1980er-Jahren hinter dem Gray's Inn Square. Der weltberühmte Soziologe -Autor von "Die Tryannei der Intimität" und "Der flexible Mensch" - lebt seit 35 Jahren in London. Aus einer jüdischrussischen Einwandererfamilie stammend, wuchs Sennett in Chicago in einem sozialen Wohnprojekt auf.
In England hat er sich ein bürgerliches Umfeld ausgesucht, aber doch eines, das geprägt ist von der urbanen Dichte einer Millionenstadt. Der Soziologe lehrte an der US-Universität Harvard Urban Studies. Hier in Bloomsbury aber ist Sennett, längst britischer Staatsbürger, zuhause: "Ich bin froh, dass ich hier bin." Die London School of Economics, an der er heute noch als Honorary Fellow aufscheint, erreicht er in elf Minuten zu Fuß.
Geschickte Darsteller wie Trump Sein neues, soeben auch in deutscher Übersetzung erschienenes Buch "Der darstellende Mensch" hat ihn wieder in die Feuilleton-Seiten katapultiert. Kein Wunder, setzt er sich doch mit einem äußerst aktuellen Thema auseinander. Im Zeitalter der Demagogen, wo "geschickte Darsteller" - wie Sennett Donald Trump in der Einleitung des Essaybandes nennt - die politische Bühne dominieren, sucht der Gelehrte Antworten auf die quälende Frage, wieso eine Mehrheit der US-amerikanischen Bevölkerung bereit ist, einen Mann zu wählen, der ganz ohne Hemmung lügt und betrügt und dafür sogar schon verurteilt wurde.
"Bühnenaufstellung, Beleuchtung und Kostümierung sind nonverbale Mittel, die bei Darbietungen aller Art zum Einsatz kommen, ebenso wie Tempowechsel bei Sprache und Klängen oder die ausdrucksstarke Bewegung von Händen und Füßen", schreibt Sennett in der Einleitung. Diese präzise Erklärung bettet er dann in ausholende, zuweilen weitschweifige Assoziationen zu Kunst, Leben und Politik ein. Der Autor arbeitet derzeit an zwei weiteren Teilen, in denen es -nach dem Thema (Selbst-)Darstellung -um Erzählen und Abbilden gehen wird.
Überleben die USA den Faschismus?
"Die Leute verstehen nicht, dass es überhaupt nicht darum geht, was Trump sagt. Es geht um seine Bildersprache." Sennett bringt Kaffee und Wasser zum Sofatisch und setzt sich auf die weiße Couch. Spricht mit sonorer, vortragsgeübter Stimme. "Trump hat eine extrem rechte Administration aufgestellt", hebt er an und betont das Wort "extrem".
Was ihm dennoch Hoffnung gibt?"Die Leute, die Trump bestellt hat, hassen sich alle. Es wird so viel Chaos geben, dass seine Schauspielkunst nicht ausreichen wird. Vielleicht bricht alles zusammen." Die Welt erlebt somit ein Echtzeitexperiment: Wie robust ist das amerikanische System gegenüber dem Faschismus?
Schon Niccolò Machiavelli habe in seiner großen Abhandlung "Der Fürst" die These aufgestellt: "Herrscher müssten Schauspieler sein, wenn sie überleben wollten", schreibt Sennett. In seinem Essay bietet er eine Zeitreise durch die Sprachkunst, die mitunter eine Studie der Demagogie ist. Von den Rednern im antiken Athen bis zu Adolf Hitler spannt sich der Bogen. Dessen Schwächen als Darsteller konnte Regisseurin Leni Riefenstahl durch gekonnte filmische Inszenierung ausgleichen: "Die schwächsten Momente in 'Triumph des Willens' aus dem Jahre 1934 kamen, wenn Hitler tatsächlich sprach und Klischees ausspuckte." Dass ein begnadeter Performer wie Donald Trump sein Talent dazu nutzt, demokratische Institutionen zu schwächen, ist natürlich ein großes Pech, darüber muss Sennett nicht mehr sinnieren. "Aber ein darstellerisches Talent kann auch für das Gute eingesetzt werden wie bei Martin Luther King. Die Kunst ist die gleiche, der Effekt aber ganz anders."
Laptop vs. Cello So unterhaltend die Exkurse sind, so fehlt doch manchmal eine schlüssige Klammer, die Sennetts Argumentation zusammenhält. Der Autor sagt selbstkritisch: "Das Buch hat einen Defekt, ich war vor zwei Jahren sehr krank und konnte nicht mit voller Kraft arbeiten." Jetzt sei gesundheitlich alles in Ordnung. Aber er vermisse seine Frau. Saskia Sassen, eine der anerkanntesten Expertinnen für urbane Soziologie, ist an Alzheimer erkrankt. Ihre Abwesenheit ist spürbar, die Wohnung ist so aufgeräumt, als fehlte es ihr an einem gemeinsamen Leben. Zwei Dinge springen in dem stillen, hellen Wohnzimmer ins Auge: ein Laptop auf dem Schreibtisch. Und ein Cello.
Das Schreiben und die Musik. Diese Leidenschaften durchziehen auch das neue Buch. Mehr als früher verbindet Sennett ästhetische Beobachtungen mit der Welt der Politik. Wie sich ein Orchester gruppendynamisch verhält und wie sich das Verhältnis zwischen Musikern und Darstellern gegenüber ihrem Publikum über die Jahrtausende verändert hat.
Vielleicht schreibt Sennett auch vermehrt über Musik, weil er sein Instrument nicht mehr selbst spielen kann. "Ich habe ja nie Soziologie studiert", sagt der Meistersoziologe, "ich wäre eigentlich gerne einfach Musiker geworden." Seine Freundschaft mit dem Geiger Yehudi Menuhin und dem Pianisten Alfred Brendel bedeute ihm viel. Das eingepackte Cello steht in der Ecke wie eine Anklage gegen das Älterwerden. Oder auch wie ein Freund, mit dem Sennett in stillen Stunden Zwiesprache halten kann.