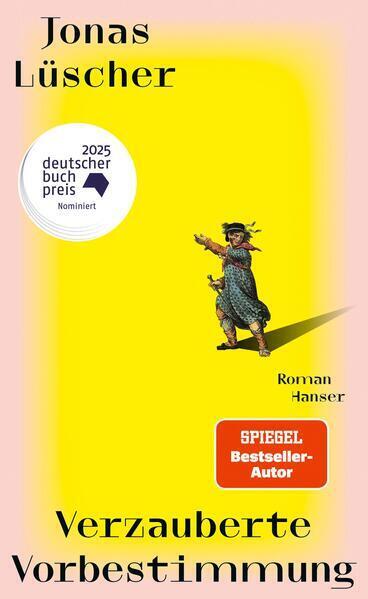Wenn der Cyborg zweimal klingelt
Klaus Nüchtern in FALTER 8/2025 vom 19.02.2025 (S. 32)
In "Verzauberte Vorbestimmung" erzählt Jonas Lüscher von einer lebensbedrohlichen Corona-Erkrankung, von den Weberaufständen des 19. Jahrhunderts oder einer Love-Story mit Androiden in Neu-Kairo. Aber ist die geschichtsgesättigte und assoziationsreiche Reflexion über die Potenziale und Ambivalenzen technischen Fortschritts tatsächlich der "Jahrhundertroman", als den ihn manche Kritiker bereits feiern?
Contra
Allein schon der Titel! "Verzauberte Vorbestimmung". Vorstellen kann man sich darunter erstmal alles oder nichts, und damit erfüllt er wohl auch seinen Zweck, suggeriert die raunende Alliteration doch gedankliche Tiefe ebenso wie poetischen Reichtum. Und hochambitiös ist das jüngste Opus des Schriftstellers und studierten Philosophen Jonas Lüscher, dessen Vorgängerroman "Kraft" (2017) mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, allemal: Sein Ich-Erzähler bereist nicht nur die südostfranzösische Gemeinde Hauterives, das nordböhmische Varnsdorf und die Planstadt von Neu-Kairo, sondern unternimmt darüber hinaus auch gleich eine Zeitreise, die von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in eine nahe Zukunft reicht.
Sieht man vom Autor/Erzähler selbst ab, gibt es in den vier Abschnitten des "Romans" von recht unterschiedlicher Länge keine Konstanz des Figurenensembles, lediglich der Schriftsteller Peter Weiss taucht wiederholt auf -im finalen Kapitel gar in Gestalt eines Vogels, der dem Ich-Erzähler auf der Schulter hockt (und warum auch nicht?).
Ästhetische Kohärenz, wie sie konventionellerweise durch eine fortlaufende Handlung, die Entwicklung von Charakteren oder einen einheitlichen Erzählton etabliert wird, ist nicht zu erkennen. Das autobiografisch-affektive Zentrum all der Reflexionen und Assoziationen, die hier zum Thema Mensch, Maschine und Transhumanismus ausgebreitet werden, bildet die Covid-19-Erkrankung des Autors, die dieser, angeschlossen an einen ganzen Technologiepark, nur als "Cyborg" überlebt.
Schon zu Beginn meldet sich der ob der hygienischen Nachlässigkeit seiner Mitreisenden verstörte Protagonist -Stichwort: Maskenpflicht - als "Direktbetroffener, schwerer Verlauf, beinahe nicht überlebt" zu Wort. Ein bisschen fühlt man sich als Leser dabei freilich moralisch erpresst. Mag oder darf man angesichts verbürgten persönlichen Leidens noch an dessen künstlerischen Aufbereitung herummäkeln? Und etwa gar ins Treffen führen, dass es verschwatzt, unsinnig, ja kitschig ist, die eigene Erkrankung als "Krieg mit Gewehrfeuer und Explosionen, mit schmierigen Gefängniszellen, Fesseln, Folter und Schützengräben, mit Fallschirmsprüngen von Bergklippen und Passfahrten" auszuschildern?
Was nervt an dieser als "Roman" deklarierten Bricolage, die genauso gut "Verschüttete Vorzukunft" oder "Vergurkte Verwandlung" heißen könnte, ist deren haltlose Selbstgefälligkeit. Alles, was dem Autor widerfuhr oder durch die Rübe rauschte, ist es auch wert, festgehalten zu werden -schon alleine, weil ER es ist, der das alles erlebt, entdeckt oder sich angelesen hat.
Selbstverständlich weiß Lüscher Profundes über ägyptische Todesmythologie oder "zur Beschaffenheit von Stirnholzpflaster" mitzuteilen; er vermag ein ganzes Dutzend historischer Hammerarten namhaft zu machen, mit denen die böhmischen Maschinenstürmer den Zahnrädern ihrer Fabriksherren nach der Keilnut trachten; er liefert nicht nur einen urologischen Befund der Harnröhre von Peter Weiss, sondern lässt uns auch wissen, dass dessen Biograf die "Engführung von Malraux, Weiss und Kleinbürgerlichkeit des Surrealismus mit einem Zitat Bourdieus unterstrichen hatte" - aber, hallo!
Gar nicht mehr einkriegen aber mag sich der endlos ennuyierte Erzähler, wenn er im apart dystopisch angeranzten Neu-Kairo die "vulgäre Abwesenheit jeglicher Idee von Kultur", die "Ansammlung von scheußlichster Sinnlosigkeit", den "Mangel an Fantasie, an Geschmack und ja, auch an Intelligenz" und die "Blödheit und Gemeinheit ausstrahlende Zusammenballung von Baumaterialien" ausmacht. Keine Frage: Da geht alles den Bach runter, und Jonas Lüscher als Einziger hat's durchschaut.
Wenn der Cyborg zweimal klingelt
Sigrid Löffler in FALTER 8/2025 vom 19.02.2025 (S. 32)
In "Verzauberte Vorbestimmung" erzählt Jonas Lüscher von einer lebensbedrohlichen Corona-Erkrankung, von den Weberaufständen des 19. Jahrhunderts oder einer Love-Story mit Androiden in Neu-Kairo. Aber ist die geschichtsgesättigte und assoziationsreiche Reflexion über die Potenziale und Ambivalenzen technischen Fortschritts tatsächlich der "Jahrhundertroman", als den ihn manche Kritiker bereits feiern?
Pro
Das ist ein Roman, der seine Leser ganz schön fordert -und sie reichlich belohnt, wenn sie sich auf dieses Lektüre-Abenteuer einlassen, denn sie verlassen den Roman klüger, als sie ihn betreten haben. Der Schweizer Autor Jonas Lüscher (Jg. 1976) organisiert seinen Erzählverlauf nicht chronologisch mittels Plot, sondern durch Leitmotive, die scheinbar frei assoziierend durch den Roman flottieren, aber tatsächlich raffiniert, nämlich rhizomartig, miteinander verflochten sind. Dies ist kein verwildertes, sondern vielmehr ein subtil konstruiertes Erzählkunststück über die konfliktreiche Beziehung von Mensch und Maschine.
Aus einem autobiografischen Kern - Lüschers eigener schwerer Covid-19-Erkrankung im ersten Pandemiejahr, an der er beinahe gestorben wäre - entwickeln sich wuchernde Erzählstränge in alle Richtungen: in die Literatur, namentlich zu Texten von Peter Weiss und Norman Mailer, in die Vergangenheit und in die Zukunft, von den Maschinenstürmern des 19. Jahrhunderts und dem Giftgaseinsatz im Ersten Weltkrieg über den Besuch des surrealen Phantasie-Palasts des Briefträgers Cheval in Hauterives bis nach Neu-Kairo, in die nicht minder surreale Verwaltungs-City in der ägyptischen Wüste.
So verbindet etwa das Leitmotiv "Ersticken" die an Giftgas sterbenden Soldaten in den flandrischen Schützengräben mit dem im wochenlangen Koma liegenden Ich-Erzähler, den nur die modernste Apparatemedizin mit einer hocheffizienten Herz-Lungen-Maschine vor dem Ersticken an Covid-19 bewahrt.
Eine tiefe Skepsis gegenüber dem technischen Fortschritt durchzieht den ganzen Roman, der vor allem das Thema Menschmaschine/Maschinenmensch in vielen Varianten vom Cyborg über humanoide Roboter bis zu Androiden durchmustert, immer konzentriert auf den dialektischen Kipppunkt, an dem die Befreiung des Menschen durch Technik in ihr Gegenteil umschlägt und nicht länger der Mensch die Maschine beherrscht, sondern umgekehrt sie ihn. Einerseits. Andererseits steht der Ich-Erzähler, der dem Autor zum Verwechseln ähnelt, zu seiner Technikambivalenz, schwankt zwischen Bewunderung für eine geniale Erfindung wie den Fliehkraftregler oder die kinetischen Kunst-Maschinen eines Jean Tinguely und Argwohn gegenüber Androiden, deren transhumane Intelligenz den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf verschwimmen lässt. So kann er sich die leblose Wüstenmetropole Neu-Kairo nur von Androiden bevölkert denken, die in der im Aufbau schon wieder verfallenden Stadtruine ihr bedenkliches Wesen treiben. Der Bericht über den Besuch in der futuristischen "Pharao City" ist einer der erzählerischen Höhepunkte dieses Romans.
Im Rückblick auf seine Nahtoderfahrung im Covid-19-Koma, als sein Körper nur durch den Anschluss "an jede erdenkliche Maschine" am Leben gehalten wurde, reflektiert der Erzähler die eigene Widersprüchlichkeit, die seine Technikskepsis relativiert: "Mein Leben war vollständig vom Funktionieren dieser Geräte abhängig, ich war ein Cyborg; mehr Cyborg war kaum möglich."
Eindringlicher als in diesem Erfahrungsbericht eines Betroffenen ist die Pandemie noch nie erzählt worden. Lüscher beschreibt die Bewusstseinszustände zwischen Träumen, Fieberfantasien und Erwachen aus dem Koma, die nicht nur sein Leben danach und seinen Blick auf die Welt gründlich verändert haben, sondern auch seine Sprache.
Dieser Autor hat eine Syntax im Repertoire, die wohltuend aufwendiger daherkommt als die banale Alltagssprachlichkeit der meisten Gegenwartsromane. All das macht aus "Verzauberte Vorbestimmung" den ersten Covid-19-Roman der Literaturgeschichte und markiert einen neuen "State of the Art" im Romanschreiben.