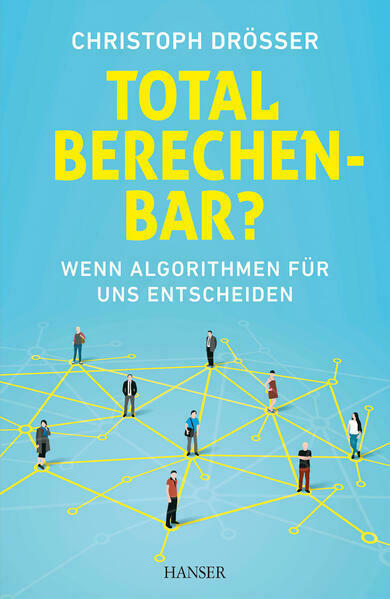Wir machen uns immer berechenbarer
Armin Thurnher in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 41)
Big Data: Algorithmen und Datenmengen stellen uns die Frage, wer entscheidet: wir oder die Rechner
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne: / sie sind genauer“, sagte der alte Enzensberger zu seinem Sohn Hans Magnus. Der zitierte Satz, halb ernst, halb ironisch, stammt aus einem Gedicht. Heutzutage müsste es heißen: Lies keine Essayisten, lies Mathematiker, die sind genauer.
An zwei Büchern kann man den Wahrheitsgehalt dieses Satzes überprüfen. Erster Eindruck: Im Zeitalter der großen Daten und der Digitalisierung tut man als Autor gut daran, Mathematiker zu sein oder zumindest mathematische Kenntnisse zu haben, sonst ist man bald kein Autor mehr.
Die Autoren der zwei Bücher, um die es hier geht, sind nämlich ausgebildete Mathematiker. Der Deutsche Christoph Drösser, Autor der Buches „Total berechenbar. Warum Algorithmen für uns entscheiden“, studierte Mathematik und entschied sich danach für die Laufbahn eines Wissenschaftsjournalisten. Der US-Amerikaner Christian Rudder begründete nach seinem Mathematikstudium in Harvard mit einem Kollegen einen Internet-Partnersuchdienst namens OkCupid.
Beide Bücher handeln von der neuen, durch Big Data und durch Algorithmen geprägten Welt. Rudder hat dafür das Wort Dataclysm geprägt, was etwa so viel bedeuten soll wie einen Abgrund, in den wir datenerfassten Menschen hineingesogen werden. Er selbst allerdings gibt gleich zu Beginn zu Protokoll, er habe nie ein Online-Date gehabt, und zu twittern sei ihm peinlich. Er wolle mit seinem Buch auch keine Kunden für seine Firma werben, sondern uns, sein Publikum, nur dazu anregen, über uns selbst nachzudenken.
Dabei geht er nicht besonders tief. Im Wesentlichen beschränkt er sich auf das Datenmaterial, das ihm durch die Tätigkeit seiner Agentur zur Verfügung steht. Die Daten sind allerdings überwältigend und auch von soziologischem Interesse.
So kann Rudder aufgrund der Präferenzen seiner Kunden Rassismus nachweisen. Schwarze Kundschaft wird einfach weniger nachgefragt, ohne dass es eine andere Begründung dafür gäbe als die Hautfarbe. Das lässt sich nun statistisch nachweisen. Wird ein Schwarzer gewählt, zum Beispiel zum Präsidenten der USA, steigt automatisch die Nachfrage nach rassistischen Witzen.
In einer Partneragentur – oder in jedem beliebigen Netz-Business – müsse man Menschen begreifen, „wie ein Chemiker vielleicht die umherwirbelnden Moleküle seiner Tinktur begreift“ und, wie Rudder hinzufügt, „zu lieben beginnt“.
Das mit der Liebe hängt zwar mit Rudders Vermittlungstätigkeit zusammen, aber Liebe ist auch nur ein Geschäft, und der Mensch mit seinen Äußerungen muss formalisiert werden, sonst ist er nicht zu gebrauchen. Hat man ihn formalisiert, kann man auch die Entwicklung von politischen Bewegungen voraussagen.
Die Software Condor stellt fest, ob in die Online-Dialoge von Protestbewegungen negative Wörter einfließen, etwa „Hass“, „nie“, „lahm“ oder „nicht“. Ist das der Fall, kann man das Kreuz über die Bewegung machen. Oh, Occupy, seufzt der Autor.
Jede menschliche Äußerung muss so hergerichtet werden, das zeigt Rudders Buch anschaulich, dass sie für eine Maschine verständlich ist. Sie muss in einen Algorithmus verwandelt werden können. Erst dann taugt die Information als Geschäftsgrundlage. Wie sehr das Verständnis menschlichen Handelns durch diese Zielsetzung präformiert wird, das kommt bei Rudder nicht zur Sprache.
Dafür serviert er uns auf seiner Reise durch die Eigenheiten des Netzes manche Plattheit („ich weiß, dass manche Menschen prinzipiell nur gute Bücher lesen“).
Wir erfahren einiges über die Art, wie wir uns ausspionieren lassen und dabei noch freiwillig mitwirken, und am Ende, wenn das Ding endlich beim Namen genannt wird, nämlich Sozialphysik, also die Kunst, Gesellschaft auf digitale Weise zu formen, bekommen wir auf dieses harte Brot nur etwas fad schmeckende humanistische Zuversicht draufgeschmiert, nämlich, dass wir „die Daten in etwas Gutes, Konkretes und Menschliches verwandeln können“.
Hoffen wir das Beste! Und hoffen wir auf die moralische Kraft des guten Willens. Wer nicht hoffen, sondern verstehen will, ist bei Christoph Drösser besser aufgehoben. Er schickt voraus, die Algorithmenkritik sei „eine deutsche Spezialität“, und schuld daran sei Frank Schirrmacher, der 2014 verstorbene Herausgeber der FAZ, der Algorithmen als Feindbild gewählt habe. Das stimmt so nicht ganz, denn Schirrmacher war es vor allem um den Missbrauch der Spieltheorie zu tun.
Drösser stimmt aber Schirrmacher implizit zu, wenn er schreibt: „Wir halten alles für berechenbar. Und machen uns selbst berechenbar.“ Algorithmen seien nichts als Werkzeuge, Dinge eben berechenbar zu machen. Schirrmacher lasse uns im Dunkeln darüber, was Algorithmen wirklich seien.
Und siehe da, Drösser füllt diese Lücke und erklärt uns ganz einfach einmal, was Algorithmen sind. Nämlich Handlungsanweisungen für Rechner, ein Problem zu lösen. Wie Kochrezepte oder Partituren Anweisungen sind, eine Speise zuzubereiten oder Musik aufzuführen.
Drössers Anliegen ist es, das Verständnis von Algorithmen als Bildungsaufgabe darzustellen. Wer nicht verstehe, wie sie gemacht werden, habe keine Ahnung, wie unsere Welt gemacht werde. Er selbst führt uns von einfachen Beispielen wie formalisierten Kochrezepten zu den Klassikern des Netzes wie Routenplanern, Google, Amazon, Netflix und Facebook, NSA und Online-Dating. In diesem Buch gehen einem die Augen auf.
Immer entscheidet der Mensch, das heben beide Autoren hervor. Diese Entscheidungen sichtbar zu machen, darum geht es. Die dunkle Zone der „neuronalen Netze“ bleibt bei Drösser auf ein Kapitel beschränkt. Es ist wichtig, dass er sie nicht unerwähnt lässt, denn dort entscheidet nicht mehr nur der Mensch, sondern auch der Rechner, wohin die Reise geht.
Es geht um künstliche Intelligenz, um selbstlernende, der Funktionsweise des Gehirns nachgebildete Riesennetze, die selbstfahrende Autos, Sprachsteuerungen und Übersetzungsprogramme erst ermöglichen. Alle einschlägigen Datenkonzerne beschäftigen sich heute intensiv mit ihnen. Es wird ebenso wichtig wie schwierig, den Punkt nicht zu verpassen, wo Maschinen uns die Entscheidung über sie und ihre Entwicklung abnehmen.