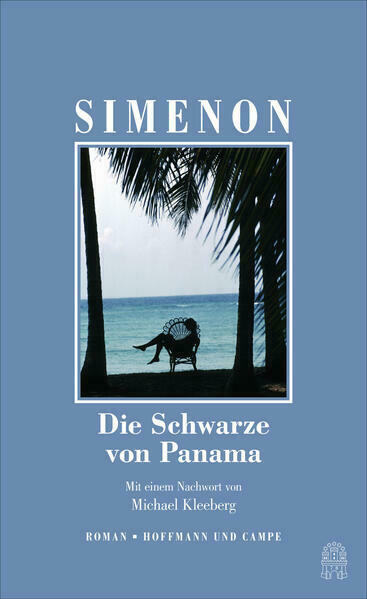Die Welt ist alles, was ein Fall ist
Claus Philipp in FALTER 41/2018 vom 12.10.2018 (S. 14)
Immer der Pfeife nach: Innerh alb von zwei Jahren soll das Gesamtwerk des Vielschreibers Georges Simenon auf Deutsch erscheinen
Da sind ja nur Neger zu sehen.“ Ein harter, heute sagt man: unkorrekter Auftakt für ein Buch, das auch in der Neuüberarbeitung seiner Übersetzung nicht um das auf den weiteren 200 Seiten in geballter Häufung zu findende N-Wort herumkommt. „Die Schwarze von Panama“, 1935 geschrieben und im Frühwerk von Georges Simenon einer der weniger bekannten Romane des Autors, ist eine Etüde über eine sich auch sprachlich manifestierende Verwahrlosung in einem kolonialistischen Sumpf, aus dem die Protagonisten, egal, ob schwarz oder weiß, kaum jemals herausfinden.
Joseph Dupuche, ein französischer Geschäftsmann, bleibt nach einer Firmenpleite in Panama hängen. Seine jüngst Angetraute will sich mit dem sich anbahnenden Misserfolg nicht abfinden, ihr Mann aber lässt sich in einer Endlosschleife aus Alkohol, Hitze und Sinnentleerung im freien Fall nicht bremsen und verliebt sich auch noch in eine schwarze Minderjährige. Am Ende erhält der Leser die folgende Information: „Dupuche starb zehn Jahre später an einer akuten Harnblutung. Er hatte seinen Wunschtraum verwirklicht: das Leben in einer der Hütten am Meer, gleich hinter dem Bahnhof, inmitten von wucherndem Unkraut und Abfällen. Er hatte sechs Kinder, von denen drei ganz schwarz und zwei Mestizen waren, während das jüngste eine fast weiße Haut hatte und nur eine bläuliche Verfärbung der Fingernägel seine Abkunft verriet.“
Der Fall Dupuche ist letztlich ein „klassischer Fall“ – zumindest für Simenon-Leser, denen der Autor in 192 Romanen und wer weiß wie vielen Erzählungen immer wieder die Schicksale von Menschen zumutet, für die eigentlich alles wunderbar laufen müsste, die irgendwann aus der Spur ausscheren, während scheinbar offenkundige Verlierer durchaus Gewinne machen.
In der dieser Tage startenden Simenon-Gesamtedition, die der ehemalige Diogenes-Verleger Daniel Kampa gemeinsam mit Hoffmann und Campe bis Herbst 2020 zu stemmen gedenkt, ist „Die Schwarze von Panama“ denn auch so etwas wie ein x-beliebiger möglicher Start in das System Simenon, in dem gilt, dass die Schwere vieler „Fälle“ durch das Lapidare des spürbar schnell Dahingeschriebenen in Balance gehalten wird.
Die Geschichte des Joseph Dupuche ist definitiv kein großer literarischer Wurf wie zum Beispiel Malcolm Lowrys „Unter dem Vulkan“ oder die Romane von William Faulkner. Aber gerade im für Simenon typischen Duktus einer Verweigerung von Einzigartigkeit verdichtet sich die Gewissheit, dass gerade Schicksale und Geschichten, die sich jeden Tag, überall, in vielen Büchern ereignen können, massiv ins Gewicht fallen.
Nicht wenige Artikel über Georges Simenon beginnen mit der Feststellung, dass Artikel über Georges Simenon schwer zu schreiben seien und dass es noch schwerer sei, einen Anfang zu finden. Mitunter behelfen sich die Verfasser solcher Artikel mit Zitaten sehr berühmter Autoren, die viele wichtige Preise erhalten haben, aber demütig einknicken vor einem „Titanen“ und „Menschenkenner“, der seinerseits nie einen wichtigen Preis erhalten habe, aber halt doch einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sei.
Sehr gerne wird auch behauptet, dass Simenons Œuvre – darunter allein 75 Romane rund um den Serien-Kommissar Jules Maigret – quasi eine Wiederaufnahme von Honoré de Balzacs „Menschlicher Komödie“ sei und auch für ihn gelte, was Marcel Proust einmal über Balzac geschrieben hat (wir zitieren ihn aus dem Gedächtnis heraus sicher falsch): Selten glänze einer der Texte für sich, vielmehr entfalte sich deren Wirkung aus dem Ensemble heraus, als bewege man sich entlang von Bildern einer Ausstellung.
Niemand, der gern und viel liest, kommt darum herum, Simenon in Serie zu lesen. Es entsteht – Stichwort „binge-reading“ – eine Sucht, die sich kaum noch aufhält mit (vorher eifrig aufgelesenen) Details, obwohl gerade in denen der Teufel sein Unwesen treibt. Man lässt sich ein auf eine Betrachtung größerer Flächen. Auf größere Geschwindigkeiten. Betrachtungen zum einen Buch ergeben Grundierungen für die Lektüre des nächsten, bis sich die Plots und Titel heillos ineinander verzwirbeln. Kann selbst und gerade ein vielbelesener Mensch aus dem Stand heraus sagen, worum es etwa in „Maigret bei den Belgiern“ oder in „Maigret zögert“ geht? Ist „Betty“ jetzt das Buch über eine Alkoholikerin, die alles rund um sich förmlich einweicht, oder waren da nicht noch viele andere Texte von Simenon über Trinkerinnen und Trinker, mit denen wir jetzt in unserer Erinnerung die Geschichte von Betty anreichern?
Anders als die Rezensenten, die davon ausgehen, dass es der Plot und das Thema seien, die zu interessieren hätten, halten zumindest wir Simenon-Leser es lieber mit einem Sound der Sprache, einer Haltung und also auch einer Form, aus der heraus sich begreifen ließe, warum wir uns zum Beispiel von einem Textkonvolut angezogen fühlen. War es der Sänger von Wanda, der seine manische Vorliebe für Columbo mit der Art begründete, in der Peter Falk die Nähe zu Tätern förmlich körperlich suche?
Egal. So geht es einem jedenfalls auch bei Maigret, bei dem viele Ermittlungen zu einer einzigen werden. Die Welt ist alles, was ein Fall ist, während Maigrets Kompagnon, Inspektor Lucas, immer wieder gerne zum nächsten Bier abschweift und der Kommissar unter dem phlegmatischen Motto „Immer der Pfeife nach!“ Menschen zu verstehen versucht bzw. sehr oft auch so etwas wie Verständnis aufbringt. Für Notlagen, aus denen heraus Abweichungen von der Norm entstehen.
Fortwährend verändern sich Simenons Werkzusammenhänge im Auge des Betrachters/Lesers, der seine eigenen Prioritäten setzt. Franz Schuh hat es einmal unter dem Topos „tropfenförmiges Weltbild“ so versucht: „Bei Simenon sammle ich (ich weiß, ich bin nicht der einzige) Regentropfen, denn er ist unter den Schriftstellern der beste Regenmacher. (...) Große Schriftsteller, und Simenon ist für mich einer der größten, haben nicht selten einfache Motive, von denen sie zum Wiederholen gezwungen werden: Immer wieder vom Regen schreiben; so kann man niemals mit dem Schreiben aufhören, und jedes Wetter ist ja nichts anderes als eine condition humaine, die sich auch in den Regentropfen spiegelt.“
Es ist nun durchaus nicht so, dass es in Simenons Büchern immer regnet. Manchmal ist der Himmel über Paris oder Flandern einfach nur verhangen, oder an der Côte d’Azur scheint eine relativ brutale Sonne (einige der besten Bücher von Simenon spielen zwischen Cannes und Antibes). Aber der meteorologische Zwang zur Wiederholung: Er fasst sehr gut, was Simenons Bücher ausmacht, von denen wohl kaum allzu viele je alle, aber nicht wenige viele gelesen haben.
Sie queren gewissermaßen eine Großwetterlage. Vor lauter Regentropfen und prismatischen Spiegelungen sieht man kaum noch, ob sich die bei Simenon vermittelte Menschenkenntnis lakonischer Abstraktion verdankt, die seine Romane meist wirklich zeitlos erscheinen lässt, oder nicht doch viel eher einer nachgerade journalistischen Präzision in der Wiedergabe von spezifischen, zeitverhafteten Milieus, aus denen heraus das Allgemeinmenschliche erst zu strahlen beginnt.
Von Balzac wird überliefert, er habe sich bemüht, „wie ein Maler“ zu schreiben. Auf Simenon übertragen könnte man behaupten: Er war der Fotograf in einer schreibenden Zunft. Was wiederum unterschlägt, dass Simenon zwar in der Tat sehr schnell geschrieben (ein Kapitel pro Tag bei durchschnittlich neun bis elf Kapiteln), gleichzeitig vor dem Schreiben aber ausgiebig recherchiert hat, welche Menschen es sind, auf die er sich da einlässt.
Wie heißen sie? Wie viel verdienen sie? Wie sehen ihre Wohnungen aus und was sehen sie, wenn sie aus dem Fenster blicken? War der Rahmen erst einmal vorgegeben, dann erledigt sich die Sache quasi von selbst. Ein Druck auf den Auslöser, und selbst wenn das Sujet fade oder etwa unscharf gerät: Im Rahmen der Vorgaben oder Auftrags „passt“ es, ist stimmig.
Momentaufnahmen für die Ewigkeit: „Dupuche saß im fahrenden Zug. Er blickte auf die vorüber gleitenden Wälder, die für den Menschen undurchdringlich waren. Er befand sich auf der Schattenseite. Er rauchte eine Zigarette und fühlte sich überaus wohl. Nicht eigentlich glücklich, aber es war ihm leicht ums Herz.“