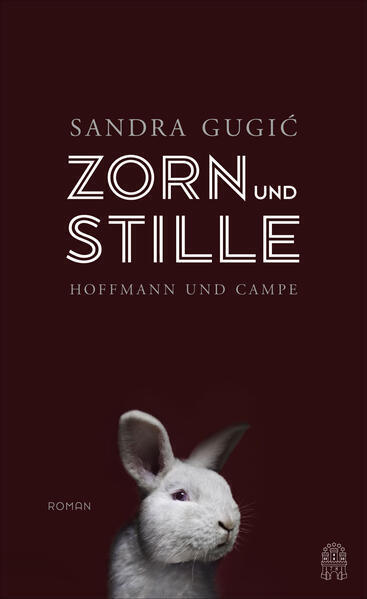Billy lebt hier nicht mehr
Sebastian Fasthuber in FALTER 36/2020 vom 02.09.2020 (S. 37)
Billy Bana ist nicht zu stoppen. Heute Wien, morgen Berlin, übermorgen Budapest. Nirgendwo hält sie es lange aus, immer ist sie mit leichtem Gepäck unterwegs. Das liegt nicht nur an ihrem Beruf als Fotografin. Fast wirkt sie panisch bemüht, nur ja keine Wurzeln zu schlagen. Fremdheit wirkt auf sie beruhigend: „Vielleicht bin ich immer gerade dort glücklich, wo ich nicht bin.“
Wie schon in Sandra Gugićs Debüt „Astronauten“ (2016) ist auch die Protagonistin ihres neuen Romans „Zorn und Stille“ rastlos unterwegs. Mit ihrem Erstling hat die in Berlin lebende Wienerin einen Großstadtroman um ein Figurenensemble erzählt, dessen sechs Geschichten miteinander verbunden waren, allerdings nicht auf den ersten Blick.
Angesichts der Erwartungen eines Publikums und einer Kritik, die zunehmend nach leicht zu konsumierenden Romanen verlangen, war der Text mit seinen verschiedenen Tonlagen mutig. Prompt wurde ihm denn auch Künstlichkeit nachgesagt. Umso größer das Aufatmen: „Zorn und Stille“ ist ein Familienroman und weniger experimentell. „Jetzt klingt jedes Wort echt“, so der Kurier erleichtert.
Doch Gugić gibt es hier nicht billiger, auch das neue Buch ist eine hochartifizielle Konstruktion aus verschiedenen Perspektiven, Zeitebenen und Schichten – mit dem Ziel, zum Kern einer Familie durchzudringen. Achtung, Spoiler: Dieser Kern entpuppt sich nicht als goldenes Herz, sondern als äußerst dünner Faden, der jederzeit zu reißen droht. Viel ist es nicht, was Familie Banadinović zusammenhält.
Die Eltern sind in den 1970ern aus den beengten Verhältnissen ihrer bäuerlichen Herkunft irgendwo im Umland Belgrads entflohen und als Gastarbeiter nach Österreich gekommen. Für die Kinder Billy und ihren Bruder Jonas Neven blieb außerhalb der Jobs wenig Zeit. Billy, die eigentlich Biljana heißt, hat viel vom Tag für sich, liest als Kind obsessiv, geht als Jugendliche auf Demos und zieht früh von zu Hause aus. Ihren kleinen, weniger starken Bruder lässt sie zurück.
Diese Familie von Einzelkämpfern erlebte selten Momente der Gemeinsamkeit. Als Teenager entdeckt Billy einen Karton mit Fotos ihres Vaters. Überraschung: Auch er muss einmal jung gewesen sein, auf einer Aufnahme wirkt er wie ein Hippie.
Erst nach dem Tod ihres Vaters beginnt Billy sich ernsthafter Gedanken über ihre Eltern, deren Herkunft und, wie diese sie geprägt hat, zu machen. Wer war der Mann, der immer alles mit sich selbst ausmachte und seine Kinder mit den Sätzen „Wie du willst“ und „Musst du wissen“ abfertigte? Eines Tages stößt Billy auf ein Video, in dem ihr Vater bereits Jahre vor seinem Tod mit einem Bestattungsunternehmer seine Überstellung nach Belgrad und die Beerdigung akribisch vorausplante.
Selten sah sie ihn so fröhlich: „Mein Vater war sein Leben lang bemüht, sein Gesicht nicht zu verlieren, hatte sich in Zurückhaltung geübt, sein Lachen war meist verhalten, auch sein Zorn war still, nach innen gerichtet, die kindliche Ausgelassenheit, die er auf den Bildern ausstrahlte, war mir fremd.“
Bilder, Geräusche und Gerüche lösen in „Zorn und Stille“ vielfältige Erinnerungen aus. Der Text hüpft munter von hier nach dort und durch die Jahrzehnte, aber er ist nur scheinbar strukturlos assoziativ. Langsam entfaltet sich die ungeschönte Geschichte vom Zerfall einer Familie, während parallel dazu Jugoslawien zerfällt.
Gugićs Familienroman ist auch ein Generationenbuch. Nicht nur Billy erzählt, ihr Vater Sima und ihre Mutter Azra bekommen ebenfalls eine Stimme. Sie erinnern sich ihrerseits – an ihre Jugend, ihre Träume, ihre Eltern. Wenig von dem, was sie beim Aufbruch aus Jugoslawien vor Augen hatten, hat sich erfüllt. Aber immerhin leben sie in einer kleinen Eigentumswohnung: „Sie hatten sich jeden dieser Räume erarbeitet. Die Freiheit, Türen zu haben, die man hinter sich schließen konnte.“