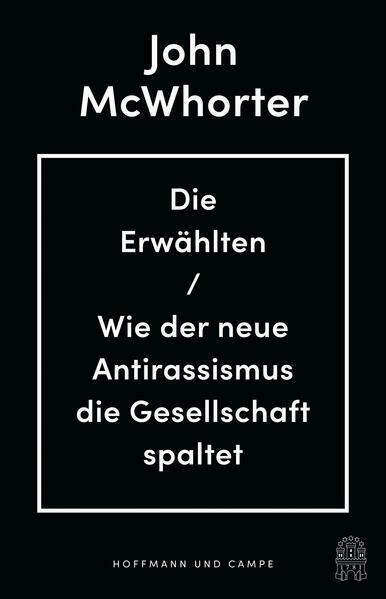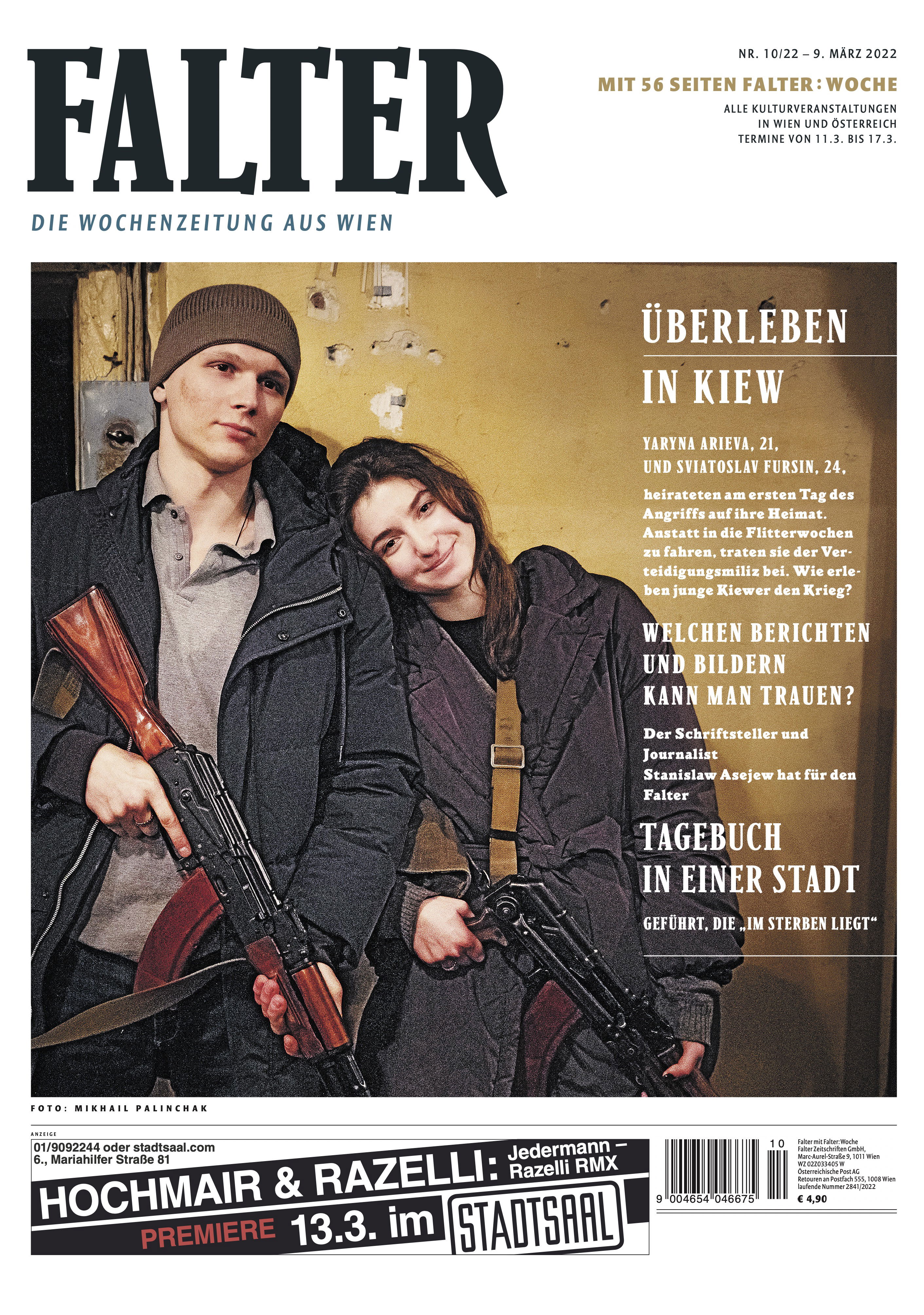
Kehrt um, Erwählte der heiligen Wokeness!
Barbaba Tóth in FALTER 10/2022 vom 09.03.2022 (S. 26)
John McWhorter rechnet in einer Streitschrift mit dem "Third-Wave-Antirassismus" ab. Furios, aber leider auch redundant
Dieser dialektische Dreh hat schon was: Was in den USA unter "Third-Wave-Antirassismus" läuft, also die Antirassismus-Bewegung, die auch schon dazu führte, dass Professoren von Universitäten und Journalisten aus angesehenen Redaktionen ausgeschlossen wurden, weil sie nicht die richtige antirassistische Haltung an den Tag legten, ist keine emanzipatorische Bürgerbewegung, sondern eine evangelikale Religion. Und damit irrational, gefährlich und entschieden zu bekämpfen.
Das ist, in aller Kürze, die Kernansage in John McWhorters Streitschrift "Die Erwählten". In der englischen Originalausgabe ist der Titel noch angriffiger -"Woke Racism. How a New Religion Has Betrayed Black America" - und sorgte im Herbst, nach Erscheinen für entsprechende Aufregung. McWhorter ist Linguistikprofessor am Center for American Studies der Columbia University in New York - und ein Schwarzer. Wäre er ein alter, weißer Mann, nicht auszudenken, welchen Eklat sein Buch ausgelöst hätte. McWhorter argumentiert den Vorwurf, Antirassismus sei zum religiösen Eifertum verkommen, konsequent durch. Eines gleich vorweg: Natürlich hält er den Kampf gegen Rassismen für wichtig, aber die Art und Weise, wie er in den USA -und inzwischen auch in Europa -geführt wird, sei kontraproduktiv.
Als Erbsünde dieser neuen Religion gilt ihm das "white privilege", also die Vorrechte, die weißen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zustünden und sie so automatisch zu Rassisten machen. Auch einen dazugehörigen Schöpfungsmythos gibt es. Er beginnt im Jahr 1619, als die ersten Sklaven an der amerikanischen Küste landeten und die weiße Vorherrschaft begann. Die Anhänger der woken Religion sehen sich als Erwählte. Wer dem antirassistischen Katechismus nicht folgt, gilt als Abtrünniger, als Ketzer. Weiße, die Wokeness hinterfragen, landen in einer diskursiven Falle. "Ich bin kein Rassist" zu sagen, geht nicht, weil alleine das Bewusstsein, keiner zu sein, beweise, dass man inhärent rassistisch denkt. Schwarze, die sich vom Third-Wave-Antirassismus abwenden, sind Verräter an der eigenen Gemeinschaft.
Ihnen droht, wie einst, die Inquisition durch die sozialen Medien. Glück hat, wer um Vergebung bittet, sich geißelt und Besserung gelobt. Alle anderen verlieren am Ende sogar ihren Job und werden geächtet, als wären sie Kinderschänder. Auch Priester und Propheten gibt es, an dreien arbeitet sich McWhorter besonders gerne ab: Ta-Nehisi Coates, Ibram X. Kendi und Robin Di-Angelo mit ihrem Buch "Wir müssen über Rassismus sprechen". An diesem Punkt zeigt sich auch die Schwäche von McWhorters Abrechnung. Streckenweise verfällt er in den gleichen Furor, den er den Anhängern der Woke-Religion vorwirft. Auch Redundanz ist ihm nicht fremd, selbst wenn er für seine sich wiederholenden Argumente jedes Mal pointierte, bissige, durchaus amüsante Formulierungen findet.
Noch wichtiger ist aber der zweite Teil seines Buchs, in dem er aufzeigt, was es statt evangelikaler Wokeness bräuchte, um die Lebenssituation von schwarzen Menschen zu verbessern. Statt das Notenniveau für schwarze Kinder an Schulen zu senken, damit sie reinkommen, brauche es eine bessere Sozial-und Bildungspolitik. Wer leichtere Zugangsregeln für schwarze Studenten fordere, infantilisiere sie. Weiße Polizeigewalt zu brandmarken ist wichtig. Wie man Gewalt von Schwarzen untereinander bekämpft, aber noch mehr. Ein woker Tweet ist schnell getippt, als "Erwählter" zu posieren einfach. Als Kämpfer gegen die "Erwählten" allerdings auch.