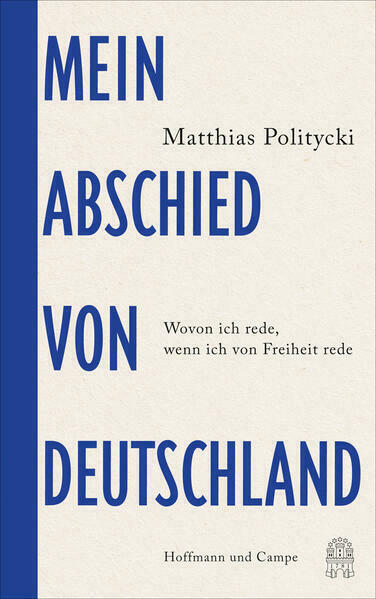"Man beginnt, sich selbst zu zensurieren"
Lina Paulitsch in FALTER 28/2022 vom 13.07.2022 (S. 28)
Der deutsche Schriftsteller Matthias Politycki will sich nicht auf "politisch korrekten" Sprachgebrauch verpflichten lassen und ist deswegen vor einem Jahr nach Wien gezogen. Ist er gut angekommen?
Vor ziemlich genau einem Jahr erklärte der Schriftsteller Matthias Politycki in einem Beitrag für die FAZ seinen "Abschied aus Deutschland". Zermürbt von den Vorgaben eines "politisch korrekten" Sprachgebrauchs, mit denen nun auch noch "die Störchin" Einzug ins Radiodeutsch gefunden hatte, sah er sich jeder Freude an seinem ureigenen Handwerk beraubt und erklärte, an einen Ort auszuweichen, "der noch sprachliberal ist: Wien".
Nun hat der Autor die Begründung seiner Übersiedlung nach Wien in Buchform vorgelegt. "Mein Abschied von Deutschland" ist ein kleiner Band mit Beobachtungen der "woken" Literatur-und Verlagsszene, die sich ob der Anti-Diskriminierung kreativ beschneiden würde. Ein guter Anlass, um den Schriftsteller im Café Zartl im dritten Bezirk zu treffen und zu fragen: Steht es wirklich so schlimm um den deutschen Literaturbetrieb? Und ist in Österreich alles besser?
Die Sympathie für die Stadt reicht jedenfalls weit zurück: 1978 hatte Politycki für ein Jahr lang in Wien studiert. Intime Kenntnisse des achten Bezirks haben Eingang in den "Weiberroman" (1997) gefunden. Mittlerweile lebt Politycki seit einem Jahr hier und fühlt sich noch immer wohl.
Falter: Herr Politycki, sind Sie denn gut aufgenommen worden hier in Wien? Haben sich die Wiener auch anständig verhalten?
Matthias Politycki: Aber ja, allen herrschenden Klischees zum Trotz. Und das fängt schon bei ganz anderen Umgangsmanieren an.
Tatsächlich?
Politycki: Ja. Da sitzt ein wildfremder Mensch auf der Bank, man geht vorbei, und der sagt einfach mal "Grüß Gott", gewissermaßen gratis, als Vorleistung für einen gepflegten Umgang miteinander. Alle meine österreichischen Freunde raunzen über das eigene Land und glauben, ich hätte eine rosa Brille auf. Aber sie kriegen hier halt gar nicht mit, wie rau das Klima in Teilen Deutschlands inzwischen ist. Wenn ich bei Rot über die Straße renne -unter Läufern nennt man das "Läufergrün" -, kann es in Wien schon passieren, dass ich mit Blaulicht verfolgt werde. Die Polizisten ermahnen mich, ich bin einsichtig, und damit hat es sich auch schon wieder. Sobald ein grundsätzlicher Respekt fürs große Ganze gezollt wird, werden gern Ausnahmen im Einzelfall gewährt. Beides muss man als Deutscher erst wieder lernen.
Die Wiener nehmen den Umweg über eine Höflichkeitsfloskel, auch wenn sie es nicht so meinen. Das unterscheidet sie von den Berlinern, oder?
Politycki: In Hamburg wird eine Fahrkarte, die man im Bus kauft, automatisch entwertet. Das ist aber nicht überall so. Also frage ich in Berlin den Busfahrer, ob ich mein Ticket noch abstempeln muss. Darauf er: "Soll ich das jetzt etwa auch noch für Sie machen?" Das Schlimmste: Er hielt sich für witzig. Woher beziehen Berliner eigentlich ihr Selbstbewusstsein? Das Bier schmeckt nicht, das Brot schmeckt nicht, der Witz ist plump, die U-Bahn kommt nicht Da fühle ich mich als Münchner der Wiener Mentalität viel näher. Schon allein der Gebrauch des Konjunktivs! Mit "hätte","könnte","würde" bleiben selbst knallharte Aussagen ein bisschen offen für den anderen, und wenn man's geschickt anstellt, kann man die These damit am Ende ins Gegenteil verkehren. Derartige Raffinessen versteht man in Berlin nicht.
Aber in München auch nicht unbedingt. Bei der Süddeutschen Zeitung ist man als Praktikantin angehalten, nicht so ironisch zu sein und den Witz auszuschreiben, wenn's denn einer ist.
Politycki: In Deutschland geht man halt schnell auf klare Kante, auch das kommt ursprünglich aus dem Norden. Im Süden gibt es einen latenten Anarchismus, selbst gegen die eigenen Ansichten; jemanden, mit dem man nicht übereinstimmt, muss man nicht gleich als Todfeind empfinden, man schafft es fast immer, wenigstens noch den Kaffee gemeinsam auszutrinken. Das, was auf Ö1 immer so abwertend als "die österreichische Lösung" verunglimpft wird, täte den Deutschen derzeit mitunter ganz gut.
Waren die Reaktionen auf Ihre "Emigration" eher positiv oder negativ?
Politycki: Ausschließlich positiv. Ich habe hunderte von Zuschriften, auch von bekannten Schriftstellern und Philosophen, bekommen, die mir versichert haben: "Mir geht's genauso, Gott sei Dank hat's jetzt mal einer ausgesprochen."
Es gab keinen Applaus von der falschen -also der rechten -Seite?
Politycki: Nein, es wurde so verstanden, wie ich's gemeint hatte. Nämlich als Kritik an der Linken -an den Auswüchsen der Wokeness -aus der linken Ecke. Man kennt mich in Deutschland ja als klassischen Linken.
Sie beklagen, dass man die Freiheit beim Schreiben nicht mehr habe, Ihnen selbst redet aber niemand drein. Ihr Lektor drängte sie sogar dazu, das "N-Wort" zu verwenden, wie Sie in Ihrem Buch erzählen.
Politycki: Ja, weil der Roman sonst nicht funktioniert hätte. Das von einem ausgesprochen woken Lektor zu hören, hat mich schon überrascht. Auf Amazon bekommt man dafür dann eine Ein-Stern-Kritik, in der man als "übler Rassist" identifiziert wird. Solche Leser sind vor lauter Weltverbesserungsfuror nicht mehr in der Lage, zwischen den Aussagen eines Autors und denjenigen seiner Figuren zu unterscheiden.
Oft wird die Redefreiheit nicht wirklich eingeschränkt, sondern es fegt ein heftiger Shitstorm durchs Netz. Gibt es die Cancel Culture tatsächlich?
Politycki: Oh ja. Und hinter den Kulissen fängt sie sogar erst so richtig an! Aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, dass einem etwa auf sehr freundliche Art nahegelegt wird, diesen oder jenen Romanstoff doch jetzt besser einmal nicht anzupacken.
Viele Ihrer Romane spielen in fremden Ländern, die Sie selbst besucht haben. Reisen Sie immer in literarischer Absicht?
Politycki: Nein, ich bin froh um jede Reise, von der ich ohne eine einzige Notiz heimkomme. Aber manchmal passieren Sachen, die so brutal oder erschütternd sind, dass sie mich nicht mehr loslassen, da springt meine Fantasie geradezu wider Willen an. Sie bringt mich dann oft zurück in diese Länder, dann laufe ich dort die Wege meiner Hauptfigur ab.
Könnten Sie über Gegenden schreiben, in denen Sie nie waren?
Politycki: Den Plot und die Substantive würde ich auch so hinkriegen, aber nicht die Adjektive und Adverbien. Je kleiner und unscheinbarer die Worte, umso eher erkenne ich, ob ein Autor weiß, wovon er schreibt. Erfahrung beginnt immer wieder neu damit, dass man genau hinschaut und das treffende Wort findet. Die Hälfte meiner Texte ist direkt vor Ort entstanden: Ich stehe im Dschungel oder im Bazar und notiere mir die schieren Fakten. In diesen Notizen ist oft schon alles drin, was beim Schreiben zum Sound werden kann.
Auch China war eines Ihrer Reiseziele, Sie haben dort einige Bücher veröffentlicht. Kann man in China eigentlich frei publizieren?
Politycki: Nein. Allerdings wissen die Verlage, nach welchen Kriterien zensiert wird, und stellen sich darauf ein. Bei einem Auswahlband meiner Lyrik musste zum Beispiel ein Gedicht rausgenommen werden.
Wieso?
Politycki: Weil es beschreibt, wie ein alter Chinese auf der Straße ausspuckt, und das "alte China" zeigt, das jetzt gezielt aus den Quellen getilgt wird. Die Spucknäpfe, die ich 1985 noch überall gesehen hatte, sind längst verschwunden. Jetzt wird selbst die Erinnerung daran ausgelöscht.
Und wie wird Deutschland von China aus wahrgenommen?
Politycki: Mit unverhohlener Wehmut. Über Jahrzehnte hinweg war Deutschland das große Vorbild, gerade für Intellektuelle. Bei meinem letzten Aufenthalt im Jahr 2019 hatte sich das gedreht, die Hälfte der Intellektuellen fand jetzt den chinesischen Weg besser. In China spielt eben der Gemeinsinn eine entscheidende Rolle. Deutschland ist den Chinesen zu individualistisch?
Politycki: Ja, einen Individualismus auf Kosten der Gemeinschaft lehnen sie ab. Und ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Etwa wenn einer ganz selbstverständlich im Ruhewagen des ICE telefoniert und die, die sich davon gestört fühlen, als Spießer beschimpft. Oder wenn sich Radfahrer auf den Radwegen bekriegen. Ich hab schon erlebt, dass sie sich geprügelt haben, weil sie sich im Recht wussten.
Sie schreiben auch, dass Sie im Ausland selbst schon körperlich angegangen wurden.
Politycki: Ja, klar. Rassismus und Sexismus gibt es auch gegenüber Weißen.
Wo war's am schlimmsten?
Politycki: In den arabischen Ländern oder gewissen Vierteln indischer Städte. Wenn Sie von einer Kinderbande in Äthiopien umringt werden, ist das auch nicht lustig. Und wenn Sie mit einer Frau unterwegs sind, müssen Sie die in sehr vielen Ländern ganz klassisch beschützen.
Wie? Haben Sie Boxen gelernt?
Politycki: Nein, ich war vor allem Fußballer und bin noch immer Läufer, habe Sport freilich immer mit einem gewissen Ehrgeiz betrieben. Sonst hätte ich viele meiner Reisen physisch gar nicht gepackt, erst recht nicht mental. Ich habe keine Angst und außerhalb Europas schnell gelernt, dass man mit der Germanistikstudent-und-Zivildiener-Nummer schnell untergeht.
Sie haben dann den Leuten einfach eine reingesemmelt?
Politycki: Das habe ich noch nie getan. Meist reicht es, eine entsprechende Körpersprache an den Tag zu legen, einen entsprechenden Ton anzuschlagen. Das mag uns als lächerliches Rollenklischee erscheinen, aber man muss es erfüllen, zumindest spielerisch.
Meiner Erfahrung nach schafft man es als weiße Frau in Afrika auch ohne männlichen Schutz. Wenn man sich angemessen verhält, muss man sich nicht schlagen.
Politycki: Schlagen muss man sich immer nur als Mann. Wenn man in Kuba vor einer Bäckerei ansteht, in der mit Peso bezahlt wird - und nicht in Dollar -, ist man, sobald das Brot nach einer Stunde Warten tatsächlich kommt, schnell mitten in einer Schlägerei. In einem Punkt haben Sie aber völlig recht: Man lernt in anderen Ländern auch bald Techniken der Deeskalation -etwa, indem man einem wildfremden Mann beim Reden die Hand auf die Schulter legt. Das schafft, ob der andere will oder nicht, einen freundschaftlicheren Umgang, großartig! Leider musste ich mir das in Deutschland dann immer wieder abtrainieren.
Noch einmal zur Gender-Debatte. Sie haben sich skeptisch zu Frauenquoten geäußert. Was stört Sie daran?
Politycki: Für eine Zeitlang finde ich sie hilfreich. Wenn man aber in den Redaktionen jeden Tag nachprüft, wie hoch am Vortag der Prozentsatz an Artikeln über Frauen war, dient das meines Erachtens nicht einer themenorientierten Berichterstattung. Quotierung kippt schnell entweder ins Lächerliche oder ins Diktatorische, beides schadet der Sache. In der Verlagsbranche sind Frauen übrigens in der Mehrheit, auch auf den Leitungsebenen, für mich ist das ganz normal.
Sie zitieren einmal Nele Pollatschek, die meint, dass, hätte man Angela Merkel als "Bundeskanzler" bezeichnet, all jene, die nie jemand anderen kannten, gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass Bundeskanzler ein Mann sein kann.
Politycki: Merkel wurde zu Beginn ihrer Amtszeit ja auch als "Frau Bundeskanzler" angesprochen. Wer die Funktion des generischen Maskulinums nicht begreift - als Möglichkeit, Menschen in ihrer Funktion anzusprechen -, ist gezwungen, jeden Aspekt unseres Lebens zu sexualisieren.
Wenn man nur von "Ärzten", statt von "Ärzten und Ärztinnen" spricht, fühlen sich Frauen nachweislich weniger angesprochen.
Politycki: Das mag inzwischen so sein, und selbstverständlich bin ich dafür, dass man Mädchen gezielt dazu ermuntert, Ärztin zu werden; allerdings mit Taten, nicht mit Worten. Für einen Schriftsteller aber ist eine Ideologisierung der Sprache in erzieherischer Absicht verheerend. Statt dass ich mich vom Sound der Sätze vorantreiben lasse, bin ich jetzt bei jeder substantivischen Wendung genötigt, innezuhalten und über Gender nachzudenken.
Das ist aber noch etwas anderes als das vielbeschworene "Man darf so heute ja gar nicht mehr schreiben!".
Politycki: Man beginnt aber ganz unweigerlich, sich selbst zu zensurieren. Da steht man dann vor dem Dilemma: Schreibe ich über Afrika, wie es wirklich ist, oder so, wie man es hier gerne sehen möchte?
Wird die Klage über den polarisierenden Charakter "woker" Identitätspolitik nicht ihrerseits von einer Lust am Polarisieren befeuert?
Politycki: Ich würde dem gerne zustimmen, kann es aber nicht, weil ich die Not auf der Seite derer sehe, die inzwischen die Gedankenfreiheit bedroht sehen. Kürzlich hat das Landesgericht Hamburg einer Autorin Recht gegeben, die dagegen geklagt hat, dass ihr Text gegen ihren Willen gegendert wurde. Gegen solche Zumutungen muss man sich heute wehren - sofern man sich's traut! Zugleich wäre es hoch an der Zeit, die Frontstellungen abzubauen. Ich wäre durchaus zu inhaltlichen Kompromissen bereit, wenn man mir dafür die Sprache unversehrt ließe. Aber bislang habe ich noch niemand von der "woken Seite" getroffen, der sich auf einen solchen Deal eingelassen hätte.