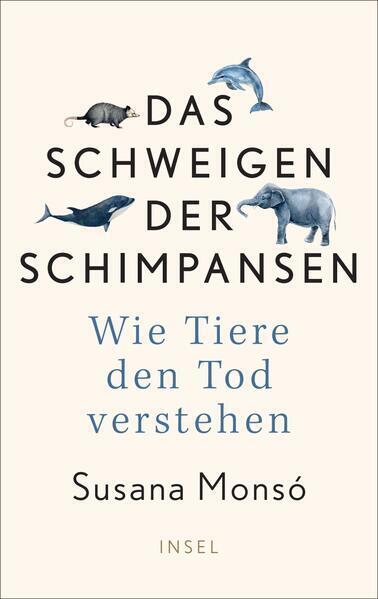Krokodilstränen
Katharina Kropshofer in FALTER 44/2025 vom 29.10.2025 (S. 43)
Tiere und der Tod - dazu fällt Marianne Wondrak sofort etwas ein. Wondrak ist Tierärztin, Verhaltensforscherin und arbeitet zurzeit auf Gut Aiderbichl in Salzburg. Sie erzählt die Geschichte des Schweins Rosine, das plötzlich in der Nacht im Stall starb. "In der Früh hat sich die komplette Gruppe versammelt: Einer nach dem anderen hat sie beschnüffelt", sagt Wondrak. Schwestern und Freundinnen legten sich neben sie. Als alle fertig waren, ging die Gruppe raus.
Eines hat Wondrak, einst Mitbegründerin des "Clever Pig Lab" an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, dabei gelernt: "Die Tiere kommen besser mit dem Tod zurecht, wenn sie den Artgenossen, dem sie verbunden waren, noch einmal sehen und berühren können." Immerhin begreifen Schweine die Welt durch ihren Rüssel, ihren guten Geruchssinn.
Ihre Geschichten sind anekdotisch. Doch sie werfen viele Fragen auf: Haben Rosines Kolleginnen wirklich um sie getrauert? Und können Schweine oder andere Tiere verstehen, wenn sich ihre Artgenossen für immer verabschieden?
"Vergleichende Thanatologie" nennt sich das Forschungsfeld, in dem Fachleute herausfinden wollen, wie Tiere auf den Tod reagieren. Eine von ihnen ist Susana Monsó. Schon rund um ihren 30. Geburtstag habe die spanische Philosophin und Tierethikerin eine regelrechte Obsession mit dem Thema Tod entwickelt, erzählt sie. Soeben ist ihr Buch "Das Schweigen der Schimpansen. Wie Tiere den Tod verstehen" auf Deutsch erschienen.
Als ehemalige Kollegin Wondraks forscht sie heute an der Fernuniversität UNED in Madrid - und bringt mit ihrer Arbeit eine gängige Annahme ins Wanken: Der Mensch sieht sich gern als Spezies mit einzigartigen Fähigkeiten. Doch die Forschung der vergangenen Jahre zeichnet ein anderes Bild. Otter verwenden Ambosse, um Muscheln zu öffnen; Krähen biegen Drähte, um an Futter zu kommen; Delfine erkennen sich selbst im Spiegel, und Honigbienen können "zählen". Wenn also nicht nur der Mensch zu komplexem Verhalten fähig ist -könnten dann nicht auch andere Tiere den Tod begreifen?
Schon die Schimpansenforscherin Jane Goodall, Anfang Oktober verstorben, hatte solche Theorien gesponnen. Im tansanischen Gombe-Nationalpark lernte sie die Schimpansin Flo und deren Sohn Flint kennen. Als Flo starb, verlor Flint seinen Lebenswillen: Er wurde lethargisch, fraß kaum noch, erkrankte.
"Als ich ihn das letzte Mal lebend sah", schrieb Goodall einmal, "war er hohläugig, abgemagert und vollkommen deprimiert und kauerte im Gebüsch nahe der Stelle, wo Flo gestorben war." An dieser Stelle rollte er sich schließlich auch selbst zusammen "und regte sich nie wieder".
So richtig Fahrt nahm das Thema 2009 auf: Damals druckte die Zeitschrift National Geographic ein ikonisches Foto der Fotografin Monica Szczupider (siehe Seite 43): Es zeigt die tote Schimpansin Dorothy. Betreuer haben sie in eine Scheibtruhe gebettet. Dahinter stehen aufgereiht 16 Schimpansen und schauen schweigend auf ihre verstorbene Gefährtin. Acht Jahre lang hatten sie in einer Rettungsstation in Kamerun zusammengelebt.
Das Bild löste eine Welle aus: Wissenschaftler und Hobbyforscher veröffentlichten ähnliche Fälle. Elefanten, Pferde, Orcas, ja sogar Krähen wollten sie bei Trauerritualen beobachtet haben.
2018 gingen etwa Bilder des Orca-Weibchens Tahlequah um die Welt. Es hatte nach einer siebzehnmonatigen Schwangerschaft ein Kalb zur Welt gebracht -das nur eine halbe Stunde am Leben blieb. Die Mutter schien den Tod nicht akzeptieren zu können. 17 Tage lang balancierte sie das tote Baby auf der Schnauze, damit es nicht unterging, folgte ihrer Familie mehr als tausend Kilometer weit, das tote Junge immer huckepack. Sie selbst aß dabei kaum. Tierethikerin Susana Monsó listet in ihrem Buch nicht nur Beobachtungen auf, sondern ordnet diese auch philosophisch ein. Ihr ist es wichtig, nicht in die vielen Fallen zu tappen: etwa, Tahlequahs Verhalten zu vermenschlichen. Vielleicht dachte die Orca-Mutter ja, ihr Junges würde noch leben, und wollte nicht, dass es zurückblieb. "Indem wir Tahlequah mit menschlichen Begriffen beschreiben, respektierten wir sie vielleicht nicht in ihrer ,Orcaheit'", beschreibt Monsó die Sorgen mancher Forscher. Als genauso großen Fehler sieht sie es allerdings, Tieren bestimmte Fähigkeiten abzusprechen, nur weil sie angeblich nur beim Menschen vorkommen sollen.
Es ist das eine, ein Verhalten zu beobachten, etwas anderes, dieses in Experimenten zu beweisen. "Das Konzept vom Tod hat drei Säulen", sagt Alice Auersperg. Die Kognitionsbiologin leitet das Goffin Lab an der Vetmeduni Wien und hat in der Vergangenheit auch mit Monsó zusammengearbeitet. Erstens: Ein Tier muss verstehen, dass etwas funktioniert hat und dann permanent aufgehört hat zu funktionieren. Zweitens: Wer den Tod wirklich versteht, muss wissen, dass dieser jedem blüht. Und drittens: die Unabwendbarkeit des Ganzen.
Auch Menschen kommen nicht mit dem Verständnis der drei Säulen zur Welt, sondern lernen sie durch Eltern oder andere Bezugspersonen kennen. Für Punkt zwei und drei braucht es also ein ausgeklügeltes Sprachverständnis, Kultur, so die Forscherin. Doch bestimmte soziale Tiere dürften ein "einfaches Konzept vom Tod" haben, meint Auersperg, oder können es erlernen.
Genau das wollen sie und ihre Mitarbeiter gerade mit Experimenten beweisen, zwei Paper liegen schon Fachzeitschriften zur Prüfung vor. Die Gruppe arbeitet mit 18 Goffin-Kakadus. Die rund 30 Zentimeter großen Vögel kommen von einem indonesischen Archipel. Ihre Gehirne sind zwar klein, aber die Neuronen darin doppelt so dicht - vor allem in jenem Bereich, der für das Lernen zuständig ist.
Schon 2011 konnte Auersperg zeigen, wie die Vögel Werkzeuge gebrauchen. Und wie gut sie darin sind. Antonio Osuna-Mascaró, Postdoc im Goffin Lab, zieht einen Beutel aus der Tasche: Zurechtgebogene Zweige, Plastikstrohhalme, sogar ein Stück Karton haben die Vögel bearbeitet, um so die Aufgaben der Forscher zu lösen. "Wir nutzen Werkzeuge als ein Fenster zu ihrem Verstand", sagt Osuna-Mascaró.
Um herauszufinden, ob Tiere ein Konzept des Todes haben, hatten US-amerikanische Forscher Krähen in der Vergangenheit tote Artgenossen vorgelegt. Hier im niederösterreichischen Labor kommt man ohne sie aus -obwohl die Vögel noch nie ein totes Tier gesehen haben. Denn im Prinzip müssen sie nicht den bedeutungsschweren Kontext kennen, sondern nur verstehen, dass etwas nicht mehr funktioniert.
"Permanente Nicht-Funktionalität" nennen Auersperg und Osuna-Mascaró das. Die Kakadus bekamen in den Experimenten irreparable Dinge oder einen Touchscreen mit entsprechenden Bildern. Die Ergebnisse können sie noch nicht verraten.
Aber wozu brauchen Tiere dieses Konzept in der freien Natur überhaupt?"Um zu überleben", meint Osuna-Mascaró. Ein toter Körper zeigt immer auch Gefahr an oder schenkt Information. Lauert ein Raubtier in der Nähe? Sollte man gewisses Futter lieber stehen lassen? Und auch ein Tiger bemerkt wohl einen Unterschied, wenn die Beute in seinem Maul plötzlich reglos ist.
Monsó und andere Forscher gehen also davon aus, dass einige Tierarten ein solches einfaches Konzept vom Tod haben -andere wahrscheinlich nicht. Insekten, vermutet Monsó, könnten den Tod wahrscheinlich nicht verstehen. Stirbt zum Beispiel eine Ameise, marschiert sofort ein Trupp an Artgenossinnen auf und befördert die Tote aus dem Nest. Doch nicht weil sie Klagegeräusche anlocken, sondern der Geruch von Ölsäure, den tote Ameisen verströmen. Durch diesen lassen sich die Tiere auch leicht täuschen: "Würden wir eine lebendige Ameise mit Ölsäure betupfen", so Monsó, "würden die anderen Ameisen sie behandeln, als wäre sie tot So sehr die ,Leiche' auch zappelt und versucht, ihren Entführerinnen zu entkommen."
Das Beispiel der Ameisen zeigt gut, was die Voraussetzungen für ein Verständnis des Todes sind. Die Wissenschaftler nennen es "die Heilige Dreifaltigkeit": Kognition, Emotion und Erfahrung. Die Tiere müssen begreifen, dass ein toter Körper nicht das tut, was man von ihm erwartet; aufspringen, fressen oder davonlaufen etwa.
Aber es braucht auch Emotion. Das muss nicht zwingend Trauer sein. Ein Kadaver kann auch Wut auslösen, Angst vor einer Gefahr oder Freude, wenn ein Tier durch den Tod eines anderen in der Hierarchie aufsteigt. Und: Die Tiere müssen im Lauf ihres Lebens oft auf Leichen stoßen, also viele Erfahrungen mit dem Tod sammeln.
Gute Kandidaten für den Besitz der "Heiligen Dreifaltigkeit" sind laut Monsó frei lebende Elefanten: Sind sie doch außergewöhnlich intelligent, können sich in ihre Artgenossen einfühlen und komplexe Reaktionen auf den Tod zeigen. Mit einer Lebenserwartung von etwa 75 Jahren haben sie auch ein hervorragendes Gedächtnis und sammeln im Laufe ihres Lebens genügend Erfahrungen mit toten Tieren.
Das schreibt auch die Wiener Verhaltensbiologin Angela Stöger in ihrem Buch "Elefanten". Die Dickhäuter gehören zu den wenigen Spezies, die intensiv mit toten Artgenossen interagieren: Sie decken Kadaver mit Blättern oder Ästen zu, versuchen, kürzlich verstorbenen Artgenossen aufzuhelfen, schreibt Stöger. Vermutlich auch, um mithilfe ihres Rüssels noch Informationen über die Verstorbenen zu bekommen.
Forscher dokumentierten auch den Fall der afrikanischen Elefantenmatriarchin Eleanor, die eines Tages zusammenbrach und am nächsten Tag starb. Während sie im Sterben lag, versuchte Grace, die Matriarchin einer anderen Familie, Eleanor auf die Beine zu helfen. Dabei war sie sichtlich aufgewühlt.
Nach Eleanors Tod kehrten zahlreiche Elefanten immer wieder zu der Stelle zurück, wo ihr Leichnam lag. Andere Forscher benennen das Bedecken von toten Artgenossen mit Erde und Pflanzen sogar als eine Art "rudimentäres Begräbnis".
Eines haben Menschen, Schimpansen, Orcas und Elefanten jedenfalls gemeinsam: Als sogenannte K-Spezialisten setzen sie auf wenig Nachwuchs - in den sie aber umso mehr Energie stecken. Auch weil dieser oft eine eigene Rolle in einem komplexen, sozialen Gefüge einnimmt. Goffi n-Kakadus leben in Paaren, legen viel Wert auf soziale Bindung in der größeren Familiengruppe. "K-Spezialisten brauchen diese sozialen Beziehungen, um zu überleben -also fällt es ihnen sicher auch auf, wenn jemand fehlt", meint der Forscher Osuna-Mascaró.
Doch es gibt noch ein Tier, das für Susana Monsó den endgültigen Beweis für ein "Konzept des Todes" im Tierreich erbringt: das Opossum. Sieht der Beutesäuger keine Chance mehr, zu entkommen, zieht er eine unglaubliche Show ab. Mit einem Schlag ist er wie gelähmt, der Gesichtsausdruck wie der einer Leiche: Augen und Mund sind weit aufgerissen, die Zunge hängt heraus und verfärbt sich blau. Das Opossum sondert eine Flüssigkeit ab, die nach Verwesung stinkt. Sogar die Körpertemperatur sinkt ab und der Herzschlag verlangsamt sich.
"In diesem Zustand eines verwesenden Kadavers bleibt das Opossum, bis die Gefahr vorüber ist. Wir könnten es kneifen oder ihm gar den Schwanz abschneiden, es würde nicht reagieren." Letzteres hätten "psychopathisch angehauchte" Wissenschaftler leider ausprobiert, so Monsó.
Das Opossum könnte auch einfach nur reglos und damit unauffällig daliegen oder stinken und so Ekel hervorrufen. Doch es geht einen Schritt weiter - und erzählt so auch etwas über seine Fressfeinde. Die getäuschten Tiere müssen ein Konzept von "tot" haben, sonst könnten sie gar nicht getäuscht werden. Sie haben wahrscheinlich auch gelernt, dass tote Tiere grauslich schmecken oder Übelkeit verursachen.
Am Ende erzählen all diese Geschichten nicht nur etwas über das Tierreich, sondern auch über den Menschen. "Wir Menschen geben dem Tod zu viel Wert", sagt der Forscher Antonio Osuna-Mascaró, "er macht uns Angst, deswegen laden wir ihn mit Bedeutung auf." Aber für viele Tiere ist der Tod simpler als das, lediglich ein kaputter Körper.
Monsó und Osuna-Mascaró sind sich deshalb sicher: Es ist relativ leicht, ein einfaches Konzept des Todes zu haben -unabhängig davon, ob die Tiere dann auch trauern oder nicht. Wobei Monsó auch an Trauer im Tierreich glaubt. Der Mensch sei dafür "das einzige Tier mit komplexen Bestattungsritualen und symbolischen Darstellungen des Todes". Und auch das einzige mit einer Vorstellung von der Unvermeidlichkeit und Unvorhersagbarkeit des Todes.
"Die Wissenschaft versucht seit langem, ein Merkmal zu finden, das uns definitiv von den übrigen Spezies trennt. Bisher sind alle Kandidaten durchgefallen. Weder der Gebrauch von Werkzeugen noch Kultur, Moral oder Rationalität sind allein dem Menschen eigen", schreibt Monsó, und auch nicht das Konzept vom Tod. Doch die Erkenntnis hat auch etwas Versöhnliches: "Wir sind keine gesonderte Spezies. Wir sind nur ein weiteres Tier."