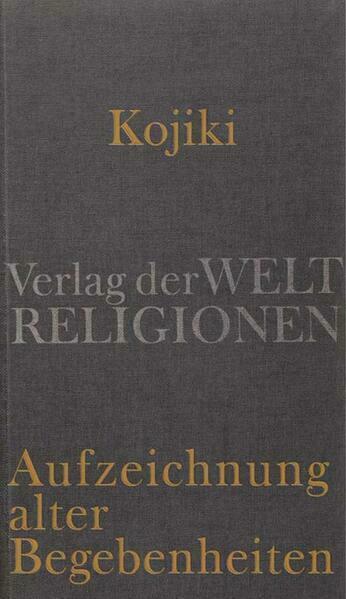Ratschläge für den nackten Hasen
Leopold Federmair in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 30)
Die altjapanische Mythensammlung "Kojiki" und die japanischen Neigungen von Claude Lévi-Strauss
Papa, erzähl mir noch eine Geschichte!" Beim Frühstück hatte ich meiner Tochter drei oder vier Episoden aus der "Odyssee" erzählt, aber dann ging mir der Gedächtnisstoff aus, und ich beschloss, ihr die Geschichte vom nackten Hasen von Inaba nachzuerzählen, die ich gerade im "Kojiki" gelesen hatte, der altjapanischen Sammlung von Mythen, Legenden und Chroniken, die zu Beginn des 8. Jahrhunderts niedergeschrieben wurde.
Meine Tochter hörte mir aufmerksam zu, ohne mich ein einziges Mal zu unterbrechen, und als ich geendet hatte, sagte sie: "Da fehlt aber ein Stück." Sie hatte recht, ich hatte den Teil ausgelassen, wo der junge Held von seinen 80 Brüdern in eine Falle gelockt wird: Sie rollen einen glühenden Stein vom Berg und machen ihn glauben, es handle sich um eine Treibjagd auf ein Wildschwein.
Der Held kommt durch das Feuer ums Leben, wird dann jedoch von einem Gott zum Leben wiedererweckt und kann schließlich die schöne Prinzessin im fremden Land heiraten. Meine Tochter kannte die Geschichte bereits aus einem ihrer japanischen Kinderbücher. Ihr Gedächtnis ist naturgemäß viel besser als meines, sie merkt sich immer alle Details.
Die Geschichte vom nackten bzw. weißen Hasen von Inaba ist in Japan Volksgut, man kennt sie in den verschiedensten Bearbeitungen. Auch Claude Lévi-Strauss schätzte sie, und auch andere Anthropologen, weil sie in allerlei Varianten in unterschiedlichen Kulturkreisen vorkommt. Eine Hypothese besagt, dass sie ursprünglich aus dem indonesischen Raum stammt, weil darin Krokodile eine wichtige Rolle spielen und es in Japan keine Krokodile gibt.
Im Mythos überlistet der Hase die der Unterwelt zugeordneten Krokodile, wird am Ende aber übermütig und ist gewissermaßen selbst schuld, dass ihm eines der Reptilien in letzter Sekunde die Haut vom Leibe reißt. Die 80 bösen göttlichen Brüder geben dem Hasen einen Ratschlag, der seine Qualen nur noch vergrößert; der junge Held verhilft ihm zu Linderung und Heilung. Lévi-Strauss stellt Parallelen dieses Geschichtenkomplexes zu amerikanischen Mythen fest und folgert, dass er Bestandteil eines über diverse Weltgegenden verbreiteten "mythologischen Systems" gewesen sei, in Japan aber eine besonders kompakte erzählerische Form erreicht habe.
Für Klaus Antoni, der nun eine neue, sicher auf lange Zeit gültige deutsche Übersetzung mitsamt Kommentar und Analyse herausgegeben hat, ist die Geschichte vom Hasen von Inaba ein Beweisstück seiner These, dass Japan schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit nicht so isoliert, nicht so einzigartig gewesen sei, wie japanische Ideologen der Moderne und ausländische Beobachter immer wieder behaupten. (Auf seine Weise vertritt auch der amerikanische Film "Lost in Translation" diese Auffassung.) Zahlreiche Argumente Antonis gehen in diese Richtung, und er insistiert auf der Tatsache, dass der Schreiber des "Kojiki" überwiegend chinesische Schriftzeichen verwendete und der Text, wie man annehmen muss, zu großen Teilen bereits auf schriftliche Quellen zurückgehe.
Vieles spricht für Antonis Abrücken von der "Phonozentrik", mitunter fragt man sich dennoch, ob er das Kind – die vielen schönen, in prähistorischer Tiefe wurzelnden Geschichten und Lieder – nicht mit dem Bade, sprich: mit der nationalistischen Ideologie, die den Mythos für ihre Zwecke missbraucht, ausschüttet. Yasumaro, der chinesisch gebildete Schreiber, räumt in der Vorrede ein, dass man nicht den "eigentlichen Wortsinn" treffe, wenn man ein japanisches Wort mit einem chinesischen Zeichen ausdrücke. Offensichtlich ist es ihm doch um eine Annäherung an dieses Eigentliche, die vorschriftliche Sprache und ihre Erzählungen, zu tun.
Antoni qualifiziert – disqualifiziert? – diese bis heute anhaltenden Versuche, das Ursprüngliche ganzheitlich festzuhalten, als romantisches Streben, das sich historisch häufig mit nationalistischen Strömungen verbindet. Als junger Student, bei seinen ersten Japan-Besuchen, sei er – wie der englische Schriftsteller Lafcadio Hearn Ende des 19. Jahrhunderts, der das europäische Japan-Bild mitprägte – selbst dafür anfällig gewesen. Der Rationalismus des Wissenschaftlers hat seine Berechtigung und fördert zahlreiche wertvolle Einzelergebnisse zutage, doch die Entzauberung, die er mit sich bringt, behindert eher die Lektüre, die Neugier und Freude, die kleine und größere Kinder angesichts eines solchen literarischen Schatzes empfinden können.
Der deutsche Text selbst, den Antoni neben hunderten Kommentarseiten bietet, ohne an "unwissenschaftliche" Leserbedürfnisse zu denken (etwa ein Figurenregister oder einen Abriss der im "Kojiki" wiedergegebenen Chronologie), ist dennoch gut lesbar und zum Glück nicht allzu streng an den im Nachwort beschworenen Übersetzermaximen der akademischen Ikone Walter Benjamin orientiert.
In seiner anthropologischen Arbeit hat sich Claude Lévi-Strauss etwas von den frühen romantischen Impulsen bewahrt, ohne dem Irrationalismus zu verfallen. Als Kind bewunderte er die bunten japanischen Holzschnitte, die ihm sein Vater schenkte, und später blieb ihm, obwohl sein Augenmerk und sein Lebensmittelpunkt lange Zeit der amerikanische Kontinent war, eine Art Japan-Sehnsucht. Einige seiner Hypothesen könnte man biografisch als Verquickung dieser beiden Seiten lesen.
Wohltuend an Lévi-Strauss' Essays zu japanischen Themen ist das sanfte Aufspüren von universal anzutreffenden Phänomenen oder Strukturen (die, wie die japanische Kultur bestätigt, häufig binär sind), während der Autor zugleich den lokalen Abweichungen gerecht zu werden versucht. Junzo Kawada, der ihn in Japan mehrmals als Dolmetscher und Vermittler begleitete, attestiert dem Franzosen einen "wenn nicht nachsichtigen, so doch bisweilen großmütigen Blick auf Japan". Das ist elegant und, ja: nachsichtig ausgedrückt, denn Lévi-Strauss sitzt hin und wieder Stereotypen auf und verkennt manch problematische Seite an Phänomenen, die er im modernen japanischen Alltag bewundert. An einem bestimmten Punkt stellt er auch selbst fest, er habe das Verhältnis der Japaner zur Natur "ein wenig zu sehr idealisiert".
Dennoch bleibt seine Aufforderung an den Westen, sich ein Beispiel an der besonderen Fähigkeit Japans zu nehmen, Tradition und Moderne, alte Werte und forschende Innovation, aber auch Mythos und Geschichte und Gegenwart koexistieren zu lassen. Antoni hätte da wohl seine Bedenken. Die Mythen sind ihm ausschließlich Studienobjekt, der Shintoismus ist für ihn eine politische Religion, die in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts zu suchen hat.
Lebt man in Japan, so erfährt man im Alltag, dass vom Shintoismus, von dieser primitiven, undogmatischen Religion, heute doch noch viel mehr wirksam ist als die Legitimation des patriarchalen Staatskaisertums, das 1945 mit der Niederlage Japans im Pazifischen Krieg de facto endete, obwohl es pro forma bis heute aufrecht ist. Wenn die Naturverehrung in diesem Land nicht nur leeres Gerede und Bildklischee ist, dann deshalb, weil etwas vom alten, im Vergleich zur griechischen Mythologie doch ziemlich wilden und unhierarchischen Götterglauben fortwirkt, den das "Kojiki" zu bewahren versucht.
Und eine Identität jenseits aller Fundamentalismen und Globalismen lässt sich nur ausbilden, wenn sich der Einzelne an einem Grundstock überlieferter Erzählungen bedienen und sie in seinem Gedächtnis speichern kann, wie es zum Beispiel meine Tochter tut.