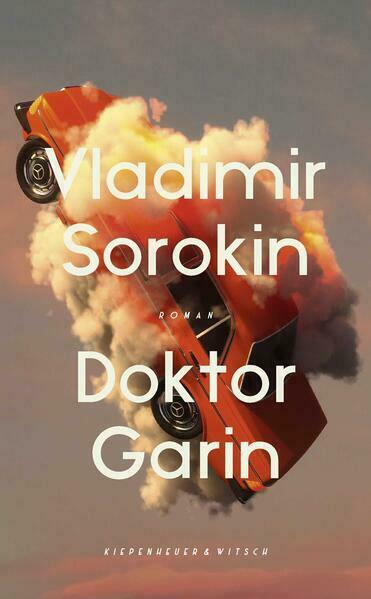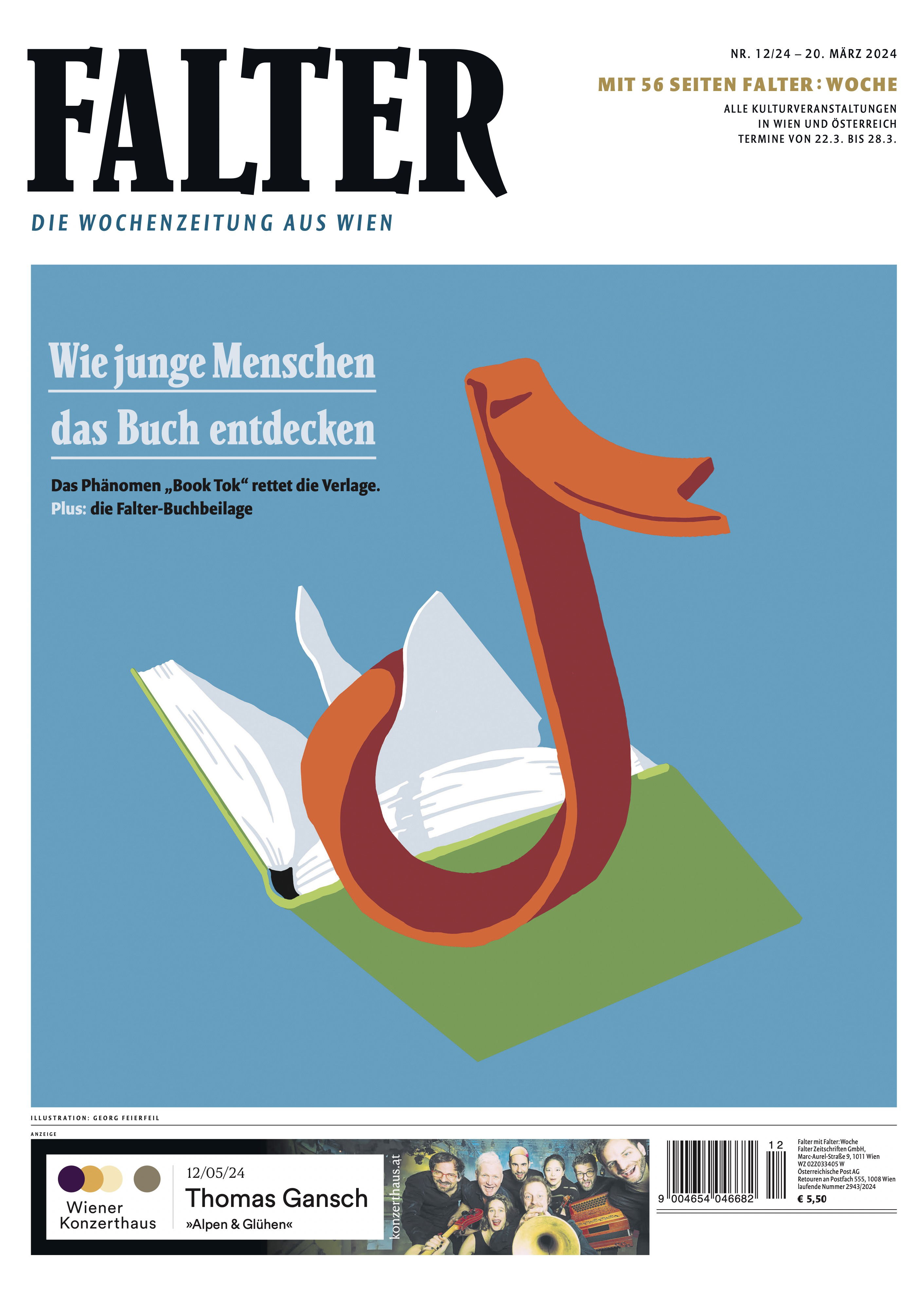
Die Kunst des Furzens
Erich Klein in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 14)
In seinen Büchern wird gefurzt, gevögelt und mit Atomraketen herumgefuchtelt. Vladimir Sorokin, 1955 in der Nähe von Moskau geboren, eilt der Ruf des Enfant terrible der russischen Literatur voraus. Tatsächlich hat der Absolvent des Moskauer Erdölinstitutes, der in der späten Breschnew-Zeit als Grafiker arbeitete, mit sehr spröden experimentellen Texten begonnen.
Schlechte Luft auf hohem Niveau: Seine frühe Beschreibung von Furzblasen, die in der Badewanne aufsteigen, wurden geadelt, als der Kunsttheoretiker Boris Groys in Zeiten der Perestrojka den Markennamen „Moskauer Konzeptualismus“ in Umlauf brachte. Sorokins frühes Meisterwerk „Schlange“ war eine sarkastische Hymne auf den real gewordenen Absurdismus des spätsowjetischen Alltags beim Schlangestehen vor einem Geschäft und eine Feier minimalistischer Literatur zugleich.
Sorokin erfand sich seitdem mit jedem Buch auch stilistisch neu. Als er mit dem Roman „Himmelblauspeck“ seinen radikalen Schreibwandel endgültig vollführte und literarischer Utopismus mit allem, was der russischen Kultur heilig gewesen war, in einen sarkastisch-wilden Taumel versetzte, fand das auch beim großen Publikum Anklang. Die Postmoderne hatte Einzug gehalten.
Frühere Weggefährten aus dem literarischen Underground warfen Sorokin ob der Verarschung von Säuleinheiligen der Intelligenzija wie Dostojewskij oder der Dichterin Anna Achmatowa Renegatentum und künstlerischen Verrat vor. Sein Spiel mit russischen Mythen und Klischees beförderte auch seine internationale Karriere.
Auf Sorokins Entmythologisierung deutscher Gedenkkultur in „Ein Monat in Dachau“ folgte jedoch germanisches Naserümpfen. Zugleich formierte sich in Russland der Protest der linientreuen Putin-Jugend gegen seine Dekonstruktion von Stalin und allen sonstigen denkbaren Sowjetheiligtümern des Totalitarismus.
Geradezu sorokin-like wurden dessen Bücher in Moskaus Stadtzentrum in einer monumentalen Klomuschel dem Orkus zugeführt. Der staatliche Aktionismus war bezeichnend für den Geist der frühen Putin-Jahre, als der Ex-KGBler an einem Tag ein Denkmal für die Oper des Stalinismus eröffnete und am nächsten Tag ein anderes für ehemalige Folterknechte.
Zum Popstar der russischen Literatur und zum Propheten russischer, immer autoritärer werdender Verhältnisse avancierte Vladimir Sorokin 2004 mit dem Kurzroman „Der Tag des Oprotschniks“. Er erzählte darin stellenweise wie einst Tolstoj; seine Beschreibung eines machtgeilen Herrschaftsklüngels um einen Fast-Monarchen, der sich von ominösen sibirischen Wahrsagerinnen beraten ließ und obskure Rituale pflegte, entstellte die Welt unter Putin zur Kenntlichkeit. Angeblich pflegt auch der Herr des Kreml in Rentierblut Bäder zu nehmen.
Russlands Herrschaftsgefüge habe sich seit dem 16. Jahrhundert und Iwan dem Schrecklichen bis in die Gegenwart nicht verändert, wird Sorokin seit geraumer Zeit nicht müde, in Interviews und Texten darzulegen.
Es war, als kehrte er zum fast beschaulichen Stil von Turgenjews „Aufzeichnungen eines Jägers“ zurück, als er 2010 in seinem Roman „Der Schneesturm“ den Landarzt Doktor Garin auf Dienstreise in einem sibirischen Unwetter sich verirren und scheinbar umkommen ließ. In seinem jüngsten auf Deutsch erschienenen Roman „Doktor Garin“ erlebt der Doktor seine Auferstehung.
Der entfernte Verwandte von Kafkas Landarzt hat sich seinerzeit nur die Füße abgefroren und bewegt sich mittlerweile auf Titanprothesen. Berührt die Krankenschwester Mascha beim Liebesspiel dessen Prothesen, erzeugt das eine hellglitzernden Ton.
Wir befinden uns in dystopischer Zukunft: Der Dritte Weltkrieg ist schon lange vorbei, das frühere Russland beinahe verschwunden. An dessen Stelle sind Gebilde wie Kasachstan oder die Altai-Republik getreten, die sich ständig gegenseitig bekriegen.
Garins leitet das Sanatorium „Altai-Zedern“. Einst prominente Politiker haben sich in das hügelige Grenzgebiet nördlich der Mongolei zurückgezogen und ergehen sich in angeregter Unterhaltung über Weltpolitik. Ihre Namen: Donald, Wladimir, Silvio, Justin, Angela, Boris, usw. Einzig der eher wortkarge Wladimir gibt im ganzen Buch nichts als den Satz „Eto ne ja – Ich war’s nicht“ von sich.
Abgesehen vom merkwürdigen Aussehen der Insassen des Sanatoriums – sie bestehen nur aus riesigen Ärschen und monumentalen Mündern samt winzigen Händchen – sowie vom gelegentlichen Einsatz eines Elektroschockers zur therapeutischen Behandlung wirkt alles wie auf einem zentralasiatischen Zauberberg. Donald und Justin ergötzen sich an der „Art of Farting“.
Die Wendung zur Katastrophe erfolgt abrupt. Abermals haben die Kasachen eine Atombombe gezündet (Wladimir schreit sofort: „Ich war’s nicht!“), Flucht ist angesagt. Die Evakuierung erfolgt mithilfe monumentaler Roboter mit dem klingenden Namen „Majakowski“. Jeweils ein Politiker wird huckepack genommen und unter der Leitung des Doktors beginnt eine Reise durch dichtes Waldgebiet Richtung Oberlauf des Flusses Ob.
„Doktor Garin“ ist ein Abenteuerroman im klassischen Sinn, ein schrilles Roadmovie, in dem weder Psychologie noch genaue Figurenzeichnung von Belang sind. Die Politiker-Patienten agieren als reine Sprachmasken. Geht eine Figur wie Boris (der einstige russische Präsident Jelzin) unterwegs verloren, hat das keinerlei Auswirkung auf die weiteren Ereignisse. Die wie in einem Stationendrama aufgefädelten Begegnungen sind umso skurriler.
In einer Anarcho-Kommune erlöst Doktor Garin die große Mutter der Anarchie, deren reale Größe die einer Barbie-Puppe ist, von ihrer Verstopfung. Eine Gruppe von Herstellern steinerner Uhren und verwahrloste Gestalten, die mittels Drohnen ihre psychedelischen „Kegel“ und „Pyramiden“ verschicken, sind nur einige Figuren dieses apokalyptischen Pandämoniums.
Als Garin auf Einladung eines Chinesen eine Shopping-Mall in Barnaul besucht, kommt Mascha, die Geliebte des Doktors, ums Leben. Er wiederum landet in einem Konzentrationslager, das von geklonten Supersoldaten betrieben wird. Am Schluss des Buches wartet indes ein Happy End, auf das der Autor selbst, der zwei Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine das Land verließ, noch warten muss.
In Berlin, wo er nun lebt, erreichte Sorokin kürzlich eine Anzeige der russischen Behörden, die dem Schriftseller LGTB-Propaganda und Kinderpornografie vorwerfen. Das bezieht sich allerdings schon auf sein jüngstes, noch nicht übersetztes Buch.