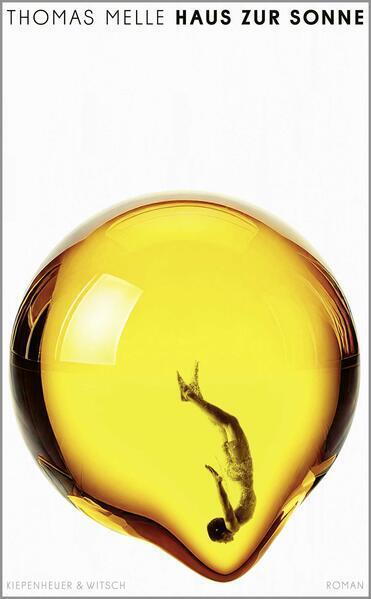Das Leben der Wünsche
Klaus Nüchtern in FALTER 36/2025 vom 03.09.2025 (S. 31)
Vor genau neun Jahren hat Thomas Melle, damals 41 Jahre alt, in seinem Buch "Die Welt im Rücken" die manisch-depressiven Schübe beschrieben, die ihm 1999,2006 und 2010 das Leben zur Hölle gemacht hatten. Der Bericht über seine bipolare Erkrankung war unverstellt autobiografisch, sodass darauf verzichtet worden war, ihn als "Roman" auszuweisen. Für den Deutschen Buchpreis, der dezidiert dem "Roman des Jahres" verliehen wird, war "Die Welt im Rücken" dennoch nominiert worden; dass dieser dann nicht an Melle, sondern an Bodo Kirchhoff für "Widerfahrnis" ging, war wohl statutengemäß, aber wahrscheinlich ein Irrtum.
Nachdem er 2022 den völlig verunglückten, zeitdiagnostisch gemeinten Sex-Lies-and-Insta-Pics-Roman "Das leichte Leben" herausgebracht hat, wendet sich Melle nun mit "Haus zur Sonne" wieder der eigenen Biografie zu, und zwar aus dem entsetzlichen Anlass, dass ihn mittlerweile eine weitere, ganze zwei Jahre anhaltende Welle der Manie überrollt hatte. Heftiger als alle vorangegangenen lässt sie Suizid als einzigen Ausweg erscheinen und bringt den Protagonisten um alles, was der sich aufgebaut hat: Vermögen, Beziehung, Freundschaften und die Reputation als Autor, die er sich mit "Die Welt im Rücken" erschrieben hatte: "Mit meinem nächsten manischen Schub hatte das Buch, so schien es mir leider, all seine Legitimation verloren. Und überhaupt, ich war nun kein Schriftsteller mehr, sondern bloß Patient, dem alles wieder um die Ohren geflogen war."
So nah am Ich des Autors der namenlos bleibende Protagonist auch situiert ist, so ist die Handlung doch auch ebenso unübersehbar in eine Fiktion eingebettet, weswegen das Buch völlig zu Recht als "Roman" deklariert wird. Nach Timon Karl Kaleytas "Heilung" und Heinz Strunks "Zauberberg 2", die beide im Vorjahr erschienen sind, beteiligt sich nun auch Melle an der Etablierung des Genres Reha-Roman - bloß dass Heilung hier keine Option ist, sondern die "Klienten", wie sie genannt werden, am Ende ihres Aufenthalts im Sanatorium verlässlich tot sind. Bei dem titelgebenden "Haus zur Sonne" handelt es sich nämlich um eine Institution, die den lebensmüden Patienten, so weit möglich, alle Wünsche erfüllt -inklusive des Hinscheidens nach präferiertem Modus. Die brieflich zugesagte Aufnahme in besagtes Haus erscheint dem Ich-Erzähler, der sich vom Leben "draußen", in dem es neben Scham, Schulden und einer verwüsteten Wohnung auch noch eine Lebensgefährtin namens Ella gibt, zunächst als Lichtblick und Hoffnungsschimmer. Das wird sich im Laufe des Romans ändern.
Während sich Strunk mit seinem selbstgefällig in Eruptionen diverser Körperflüssigkeiten schwelgenden "Zauberberg 2" in zahlreichen Anspielungen auf das 1924 erschienene "Prequel" von Thomas Mann bezieht, orientiert sich Melle mit "Haus zur Sonne" eher Richtung Dystopie und Science-Fiction.
Die Insassen der Klinik, die dafür ihr schriftliches Einverständnis gegeben haben, werden durch die Verabreichung von Sedativa, Psychopharmaka und Drogen sowie durch anderweitige neurophysiologische Manipulationen in Bewusstseinszustände versetzt, die ihren Wunschfantasien entsprechen. Jedenfalls behauptet das die Anstaltsleitung. Zeigen sich die Patienten skeptisch und bestreiten etwa, sich so etwas Doofes wie einen Lottogewinn erträumt zu haben, besteht das Ärztepersonal darauf, dass es sich eben um geheime Wünsche handle, derer sich die Betroffenen gar nicht bewusst gewesen seien.
Im deutschen Feuilleton wurde "Haus zur Sonne" weitgehend euphorisch rezensiert, als "wilde, ungezähmte Poesie"(SZ) und "vertracktes Meisterwerk" (FAZ) ausgepreist und mit Anthony Burgess' "Clockwerk Orange" oder den Romanen von Clemens J. Setz verglichen. Das ist indes um einiges zu hoch gehängt. Dass die Depression mit ein wenig anderen Worten und Metaphern stets noch einmal beschrieben wird, vermittelt gewiss ein realistisches Abbild der Marter, die niemals zu enden scheint, beschert aber auch eine ermüdende Lektüre und wenig neue Erkenntnisse. Von der Verstörung, die etwa von ähnlichen manipulativen Konstellationen in den Storys des US-Autors George Saunders ausgeht, ist hier wenig bis gar nichts zu spüren.
Melle hat es schlicht verabsäumt, seinem Roman ein glaubwürdiges Setting zu verpassen. In welchem gesellschaftlichen Rahmen das "Haus zur Sonne" funktioniert, bleibt völlig ungeklärt, und obgleich das Figurenensemble sehr überschaubar ist, gewinnen die Charaktere kaum Konturen.
Ob zeitdiagnostisch, satirisch oder dystopisch: Der Reha-Roman lebt davon, dass die alltäglichen Routinen und Rituale liebevoll und detailfroh beschrieben werden. Sieht man von einigen ganz witzigen Dialogen ab, hat der Autor hierin viel zu wenig investiert. "Haus zur Sonne" steht nichtsdestotrotz auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Nicht auszuschließen, dass ihn Melle diesmal gewinnt. Es wäre wieder ein Irrtum.