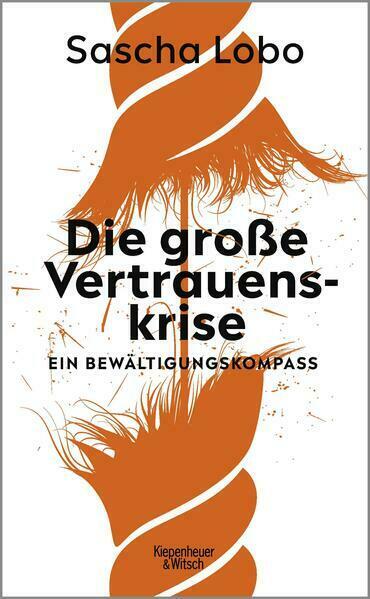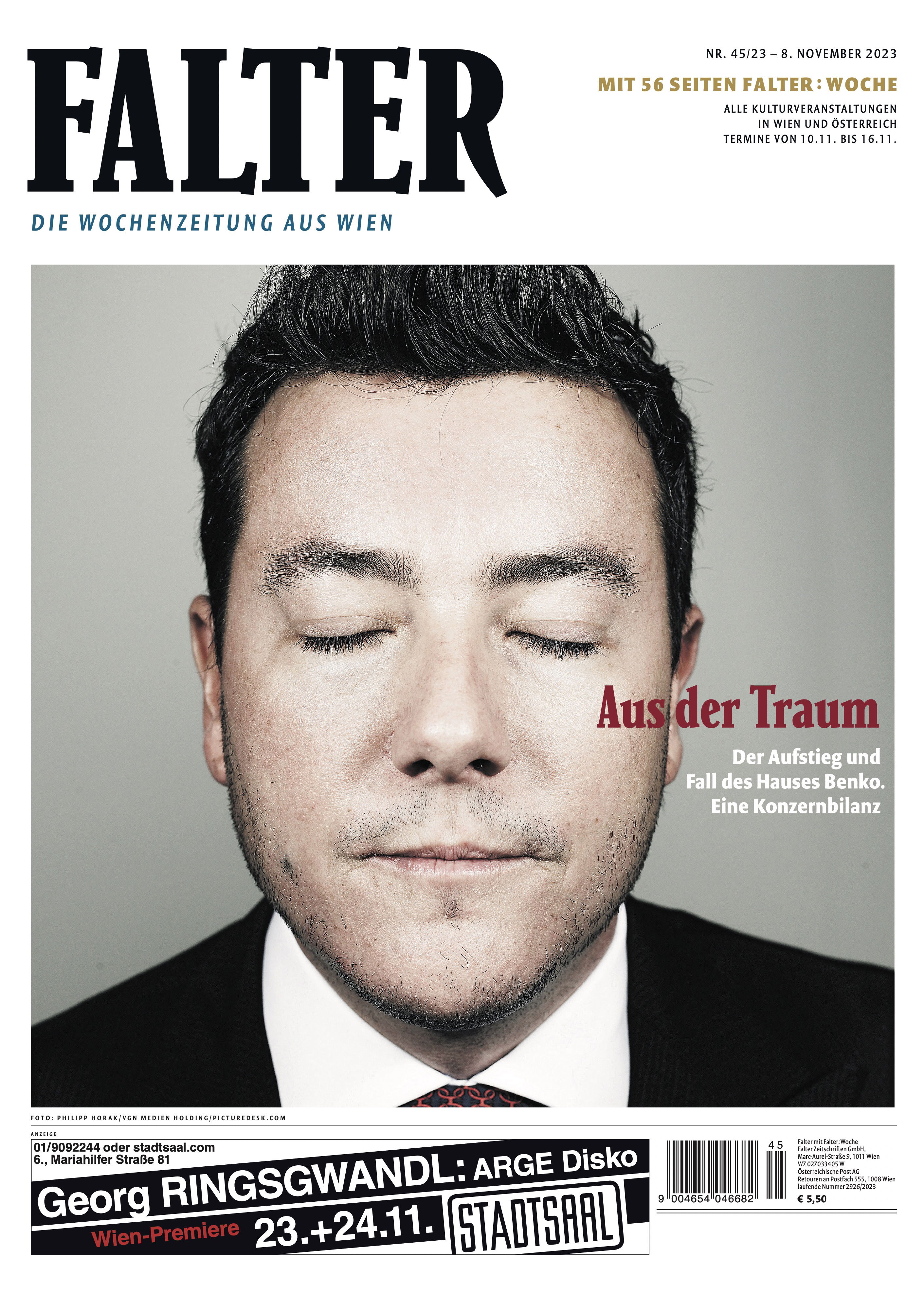
Wieso vertrauen wir den Medien nicht mehr, Herr Lobo?
Florian Klenk in FALTER 45/2023 vom 08.11.2023 (S. 20)
Wie kommen wir im Nachrichtengewitter noch zurecht? Der Netz-Kolumnist Sascha Lobo über die "Vertrauenspanik" und das "Transparenzdiktat"
Corona, Ukraine, Nahost und Inflation: Die multiplen Krisen überfordern die Gesellschaft. Eine Vertrauenspanik erfasst auch das aufgeklärte Milieu. Was ist zu tun? Der deutsche Kolumnist und Publizist Sascha Lobo hat soeben ein bemerkenswertes Buch zum Vertrauensverlust vorgelegt ("Die große Vertrauenskrise", Verlag Kiepenheuer & Witsch), der vor allem auch durch soziale Medien befeuert wird. Im Folgenden nun ein Gespräch über Auswege aus der Kommunikationskrise. Es ist eine redigierte und gekürzte autorisierte Fassung, das Gespräch kann man im Original auf falter.at/radio auch als Podcast nachhören.
Falter: Herr Lobo, Sie attestieren in Ihrem neuen Buch eine sogenannte Vertrauenspanik, einen Verlust des Vertrauens in Politiker und Wissenschafter. Diese Panik schlage gegenüber Medien durch und bedrohe unsere Gesellschaft. Ist das etwas Neues? Sascha Lobo: "Vertrauenspanik" beschreibt einen gegenwärtig verbreiteten Zustand. Er kann sich zu einer langen Phase auswachsen, wo Menschen erkennbar an allem zweifeln. Ihr Vertrauen implodiert, sie empfinden dieses Gefühl als zerstörerisch, es macht sie wütend und sie wollen diese Wut weitertransportieren. Diese Panik ist also ansteckend und das ist in Zeiten der sozialen Medien ein großes Problem.
Erleben Sie das dieser Tage rund um den Nahost-Konflikt?
Lobo: Ja, und leider auch bei jenen politischen Bewegungen, die ich für ungemein wichtig und fortschrittlich halte. Fridays for Future International etwa hat in den letzten Tagen nicht nur extrem einseitige und in meinen Augen eindeutig antisemitische Instagram-Postings zum Anschlag der Hamas in Israel publiziert, sondern auch erklärt, die westlichen Medien würden uns in Sachen Israel prinzipiell belügen. Das zeigt exemplarisch, wie Radikalisierung oft darauf basiert, dass Medien nicht mehr vertraut wird.
Fridays for Future Deutschland und Österreich haben sich mittlerweile distanziert. Müssen wir den Fall dennoch ernst nehmen?
Lobo: Ja. Es gibt etwa eine ganze Reihe von Studien, die uns erklären, wieso sich einst Jugendliche für den Islamischen Staat engagiert haben. Ein Frühwarnzeichen war wie bei vielen Radikalisierungen ein enormer Vertrauensverlust gegenüber großen Leitmedien. Auch auf dem Account von Fridays for Future hieß es plötzlich: Die westlichen Medien betreiben Gehirnwäsche, um euch auf die Seite Israels zu ziehen. Es wird eine jüdische Medien-Weltverschwörung herbeifantasiert. Und zugleich werden Links zu antisemitischen Accounts weiterverbreitet. Einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Er feierte das Hamas-Massaker als einen Tag, auf den man stolz sein könne. Einen solchen Account zu teilen und zugleich den "Lügenpresse"-Vorwurf zu erheben, das ist der vorläufige Endpunkt eines kompletten Vertrauensabsturzes jener Menschen, die nicht nur ich bis dahin zu den wichtigsten Jugend-Aktivistinnen und -Aktivisten des 21. Jahrhunderts gezählt habe.
Sie beschreiben ausführlich, wie das Vertrauen gegenüber politischen Entscheidungsträgern aus verschiedenen Gründen abgewrackt wurde. Weil Politiker falsch entschieden oder in
Krisen falsch kommuniziert haben. Erleben wir Medien, die über dieses Politikversagen berichtet haben, den Vertrauensverlust als Kollateralschaden eines generellen Misstrauens?
Lobo: Wir erleben zunächst einmal eine enorme "Nachrichtisierung der Welt", also die dauernde Beschäftigung mit Nachrichten. Schauen wir uns mal an, wie Anfang der 90er-Jahre Nachrichten konsumiert wurden. Auf dem Weg zum Büro hat man Radio gehört, dann morgens eine Zeitung gelesen, vielleicht ein wöchentliches Magazin durchgeblättert. Und dann hat man einem der Vorgänger von Armin Wolf dabei zugeschaut, wie er am Abend im Fernsehen die Welt erklärt. Man war einem Nachrichten-Gesamtvolumen ausgesetzt, das überschaubar war. Heute steht man den ganzen Tag im Nachrichtengewitter, rund um die Uhr. Selbst im WhatsApp-Familien-Chat geht es rund, weil eben dieser eine Onkel ständig irgendwelche Artikel rausballert, die einen gereizt stimmen. Die "Nachrichtisierung" bedeutet, dass man wahnsinnig vielen Nachrichten ausgesetzt ist, dass es sehr schwer wird, dem Weltgeschehen zu entfliehen, dass es sehr schwer wird, bestimmte Sachen nicht mehr mitzubekommen. Der Vertrauensverlust gegenüber klassischen Medien liegt nun auch daran, dass in sozialen Medien besonders schlimme, besonders schwierige, besonders wütend machende, besonders traurig machende und besonders Angst machende Inhalte sehr viel eher geteilt, algorithmisch verbreitet und konsumiert werden.
Wie neu ist dieses Phänomen? Wurden Menschen nicht immer schon von Nachrichten überfordert?
Lobo: Tatsächlich ist es nicht neu, zu behaupten, dass alles immer schneller wird, dass dem einzelnen Individuum alles viel zu viel werden kann. Wir erleben das mit jeder neuen Medienrevolution, ob das der Buchdruck war oder auch spezielle Formen des Buchvertriebs, die im 17. und 18. Jahrhundert in Mitteleuropa eine Art Revolution dargestellt haben, die Tageszeitung oder das Radio. Aber diese Empfindung kann heute leichter ausgenutzt werden.
Was also ist neu an der Welt der sozialen Medien?
Lobo: Die Geschwindigkeit, die Intensität und die Reichweite einzelner Personen in der Masse. Theoretisch kann heute fast jede Person weltweit ein Millionenpublikum erreichen. Wir sehen nun mit so vielen Augen und hören mit so vielen Ohren wie nie zuvor in unserer Geschichte und wir hören so viele unterschiedliche Menschen -darunter auch viele Hetzer und Propagandisten.
Der Traum der Neunziger, dass die digitale Vernetzung der Individuen etwas Aufklärerisches bewirken wird, entpuppt sich also als Albtraum?
Lobo: Nicht nur. Völlig unbestreitbar waren viele Entwicklungen - zum Beispiel durch soziale Medien -sehr positiv, auch wenn sich das vielleicht im Moment nicht so anfühlt. Wir hörten plötzlich die Stimmen von vielen Menschen, die vorher keine hatten. Das hat die Befreiung der Gesellschaft in sehr vielen selten wertgeschätzten Fällen vorangebracht.
Aber vernetzt haben sich auch jene, die sich einreden, dass die US-Demokraten im Keller einer Pizzeria Kinder fressen.
Lobo: Die Verschwörungstheorie namens Pizzagate, die Sie da ansprechen, ist tatsächlich eine Art Ausgangsmaterial für eine der gefährlichsten Verschwörungstheorien des 21. Jahrhunderts: QAnon. Dabei unterstellten wahnwitzige Leute Hillary Clinton, sie würde im Keller einer Pizzeria in Washington, die übrigens gar keinen Keller hat, einen Kindermissbrauchs-Ring betreiben. Ausgangspunkt war vor allem der Hack der E-Mails von Clintons Wahlkampfteam.
Entstanden ist der Mythos der rechtsextremen Verschwörungsbewegung QAnon daraus, dass die Leute Pizzen bestellt haben und dabei "CP" schrieben für "Cheese Pizza".
Lobo: Das wurde dann von Gegnern zur Abkürzung von "Child Pornography" umgelogen. Der Fall zeigt, wie gefährlich Vertrauenspanik eskalieren kann. Es war die Geburtsstunde des QAnon-Netzwerks, das den politischen Diskurs in den USA messbar destabilisiert hat. QAnon führte zu weit über einem Dutzend Toter, der rassistische Anschlag in Hanau zum Beispiel basiert zum Teil auf dieser Verschwörungstheorie. Das weiß man aus den Hinterlassenschaften des Attentäters. Es gibt weitere Anschläge, die sich ganz konkret auf QAnon beziehen. Millionen Amerikaner glauben, dass eine linke Elite unterirdische Kinderfarmen betreibt, um den entführten Kindern ein spezielles hormonelles Stoffwechselprodukt abzuzapfen.
Und jetzt haben wir ein politisches Personal, Stichwort Trump, das diesen Verschwörungsmythen nicht mehr entgegentritt, sondern diese befeuert, um Wahlen zu gewinnen. Ist es so einfach? Lobo: Verkürzt: ja. Der gemeinsame Nenner der meisten populistischen Bewegungen ist das Schüren von Angst, und Angst gehört zu den wichtigsten Gegenspielern von Vertrauen.
Sie kritisieren nicht nur die Ausbeutung von Angst, sondern auch schlicht unprofessionelles Krisenmanagement als Ursache der allgemeinen Vertrauenspanik. Etwa in der Pandemie.
Lobo: In der Pandemie sind verschiedene Kommunikationssysteme völlig unvorbereitet aufeinandergeprallt. Auf der einen Seite war die Wissenschaft, die in Theorien und Wahrscheinlichkeiten denkt und sich meist vorsichtig äußert. Und auf der anderen Seite stand die Politik, die von einer Wählerschaft abhängt, die größte Klarheit einfordert. Und das verleitete sehr viele Menschen in allen Sphären dazu, Klarheit herzustellen, bevor sie wissenschaftlich fundiert war. In der Maskendebatte war das in Deutschland sehr stark zu spüren. Ich habe mir Aussagen vom damals amtierenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der ersten großen Corona-Welle im Januar 2020 durchgesehen. Ganz zu Beginn sagte er wörtlich, Masken schützen nicht, denn das Virus werde nicht mit Atem übertragen. Das sagte der Gesundheitsminister! Und er kommunizierte nicht, dass das der derzeitige Wissensstand sei, sondern er verbreitete diese Hypothese wie eine Wahrheit.
Er wollte Sicherheit vermitteln.
Lobo: Absolut. Er versuchte, das öffentliche Vertrauen und auch die Ruhe, die für eine Demokratie wichtig ist, zu gewährleisten, und ließ sich dazu hinreißen, Sachen als klar hinzustellen, die nicht so klar sind. In Deutschland kommt die mangelhafte Fehlerkultur dazu, auf Fehlern zu beharren, statt sich zu entschuldigen oder zu korrigieren.
Sie bieten in Ihrem Buch einen "Bewältigungskompass" für die Vertrauenskrise. Wie sieht der aus? Haben wir in dieser von Social-Media-Nervosität und Angstmache geprägten Welt eine optimistische Perspektive? Lobo: Ja, die gibt es. Aber dazu müssen wir akzeptieren, dass wir Vertrauen im 21. Jahrhundert, im vernetzten 21. Jahrhundert anders herstellen müssen als im 20. Jahrhundert.
Sie bringen das Beispiel des Korrespondenten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der sich in den Neunzigern vor die Kamera stellte und signalisierte: Ich bin der, dem du vertrauen kannst.
Lobo: Das Beispiel zeigt, dass Vertrauen im 20. Jahrhundert eine Art institutionelle Vereinbarung war. Man hat von Seiten der Bevölkerung viel eher großen Leitmedien, Repräsentanten der Wissenschaft, großen Institutionen vertraut. Es galt unausgesprochen oft etwas wie: "Okay, wir haben jetzt einen Deal, wir vertrauen euch halbwegs, dass ihr das einigermaßen hinkriegt, und ihr belästigt uns dafür nicht mit anstrengenden Details und könnt eure Macht ausüben." Im Zweifel hat man nicht so genau hingeschaut, weil man nicht so genau hinschauen konnte. Plötzlich ist mit der digitalen und der sozialen Vernetzung eine Sphäre entstanden, wo dieser Deal nicht mehr funktioniert. Dieser eine Korrespondent, der da vor diesem komischen Haus steht und irgendwas sagt, ist im Netz auf einmal mit 520 abweichenden Wortmeldungen konfrontiert.
Andere Perspektiven hören zu können, das wäre ja für sich schon eine Bereicherung.
Lobo: Ja, aber es ist auch ein Einfallstor für Propaganda, für ideologische Manipulation und für Lügen. Vertrauen oder noch besser neues Vertrauen muss im 21. Jahrhundert daher prozessualer hergestellt werden, viel transparenter und dialogischer.
Das müssen Sie uns jetzt genau erklären.
Lobo: Es geht nicht mehr um Momentaufnahmen, sondern um einen tiefen Einblick in die Genese von politischen Entscheidungen und die Produktion von Medien. Wir haben ein Transparenzdiktat. Menschen erwarten plötzlich eine Transparenz, die vor der Verbreitung des Internets undenkbar war. Sie erwarten nun, dass Dinge im Zweifel veröffentlicht werden sollen, nach denen man früher nie gefragt hat. Ich habe das erstmals rund um die Verhandlung von TTIP erlebt, dem transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, Stichwort "Chlorhuhn". Früher konnte so etwas hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Denn wer würde schon eine Broschüre bestellen per Post, um sich das Thema ganz genau anzuschauen? Und plötzlich kommen die Leute und sagen: Hey! Ich möchte, dass das transparent verhandelt wird, ich möchte, dass so ein Abkommen nachvollziehbar ist. Und wenn das nicht passiert, ist es ein Grund, sofort zu zweifeln.
Was bedeutet das für den Journalismus?
Lobo: Zweierlei. Zum einen müssen Medien darauf hinarbeiten, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Maß an Aufgeklärtheit braucht. Das Publikum muss eine gewisse Form von digitaler Bildung haben, damit es nicht den allerletzten Unfug auf Telegram glaubt und sich denkt, dass das dort vom Bruder des Tennislehrers geteilte Video viel wichtiger und richtiger ist als alles, was die großen Leitmedien recherchiert haben. Ältere Leute sind einzelnen Untersuchungen zufolge für Fake News anfälliger, jüngere erkennen Fake News leichter, jedenfalls abseits von Verschwörungserzählungen.
Junge Leute schauen in den Postings schneller in die Kommentare, um zu prüfen, was andere zu einem Posting sagen.
Lobo: Das stimmt, als Abgleich. In vielen Fällen kriegt man aus den Kommentaren so eine Art "Publikums-Joker", eine Art Crowd Intelligence mitgeliefert, die natürlich auch falsch liegen kann, wo aber so etwas wie ein spontanes Vertrauenskollektiv entsteht, als Korrektiv. Wikipedia ist ein sehr, sehr spannendes Beispiel dafür. Vor 25 Jahren hätte man wohl noch keiner Website vertraut, in die alle Leute reinschreiben können. Heute gehört Wikipedia quer über die ganze Welt zu den vertrauenswürdigsten Webseiten, die überhaupt existieren, gerade weil dort alle reinschreiben können. Die Menschen spüren, dass da ein Vertrauenskollektiv am Werk ist, das transparent schreibt, debattiert und editiert. Das ist neues Vertrauen, das ist ein Teil der Lösung.