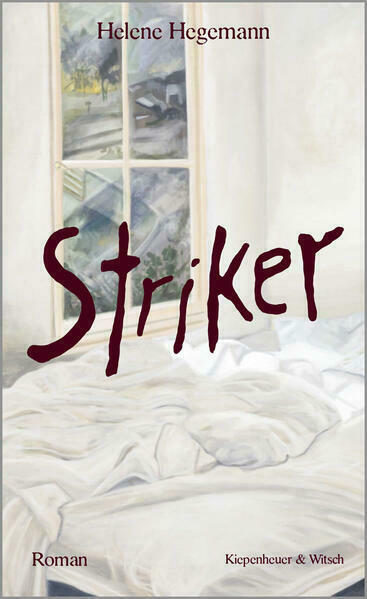Doppelgängerin im Boxring
Lina Paulitsch in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 16)
Frauen im Kampfsport sind gerade en vogue. Man denke an Florentina Holzingers rezente Box-Performance im Film „Mond“ oder an das Bodybuilder-Epos „Love Lies Bleeding“ von Rose Glass. Auch die Literatur bietet eine Reihe von Protagonistinnen, die sich im Ring selbst ermächtigen. Oder abreagieren.
Jüngstes Beispiel ist Helene Hegemanns „Striker“. Die Protagonistin namens N. unterrichtet an einer privaten Schule für Selbstverteidigung. Sie trainiert Banker, Oligarchenwitwen und anorektische, wohlstandverwahrloste Mädchen. Mit einer ihrer Schülerinnen, einer wesentlich älteren, hochrangigen Politikerin, hat N. ab und zu Sex. Das Affären-Dasein gefällt ihr nur so halb.
Überhaupt zählt die Euphorie nicht zu N.s Stimmungsrepertoire. Die Welt in diesem Roman ist düster, deprimierend und hart. Oder in den Worten der Erzählerin: „Es wirkt, als hätte jemand seinen Aschenbecher in der Fassadenfarbe ausgeleert, eine trübe Fläche, die nicht zu durchdringen ist.“
N.s gleichförmiges Leben gerät aus den Fugen, als sie Graffitizeichen an ihrer Hausmauer entdeckt. Überall in Berlin nimmt sie plötzlich die Symbole des titelgebenden Striker wahr, eines Influencer-Sprayers. Auf Youtube und Instagram filmt er seine illegalen Stunts, bei denen er sich von Dächern abseilt, um in den obersten Stockwerken seine Tags zu verewigen. Obsessiv beschäftigt sich N. mit Striker, „die ganze fucking Zeit“.
Dann tauchen Koffer und Matratze vor ihrer Türe auf. Ivy, so wie N. Ende zwanzig, campiert im Stiegenhaus und erklärt, eine Wohnung zu beziehen. Ihre Behauptung, sie sei Strikers Freundin, erweist sich schnell als zweifelhaft. Ivy ist verwahrlost, distanzlos und unheimlich. Sie möchte zu N. in die Wohnung und jagt ihr, allen Kampfsportreflexen zum Trotz, einen Schauer über den Rücken. Ivy wird zur zweiten Protagonistin dieses Buchs.
Weil sie sich auch äußerlich ähneln, erkennt N. in Ivy ihre Doppelgängerin – ein negatives, verrücktes Abziehbild ihrer selbst. Später offenbart sie sich tatsächlich als obdachlose Schizophrene mit einer Vorliebe für N.s Wohnhaus. N. fühlt sich existenziell bedroht. Als könnte Ivy sie aushöhlen, überschreiben und ersetzen. Man müsse, so betet sich N. in Kampfsportmanier vor, seinen „Doppelgänger töten, um nicht selbst getötet zu werden“.
Mit N. hat die 33-jährige Helene Hegemann ein Gegenbild zum Klischee ihrer eigenen, hypersensiblen Generation entworfen. Jedes Mal, wenn N. boxt, vor Schmerz ohnmächtig wird oder sich ein Stück Zunge abbeißt, denkt sie mantraartig: „Du bist nicht so wichtig.“ Oder: „You are worthless.“ Hart sind auch die Umstände, unter denen N. ihr Dasein fristet. Obwohl sie es sich nicht leisten kann, shoppt sie unnötiges Zeug im Internet und wirft es anschließend weg. Wohnungen sind unleistbar, ein Krieg scheint unausweichlich. N.s Boxkampf steht zugleich für ihren Überlebenskampf.
Die durchaus interessanten Motive, die der Roman liefert, werden allerdings nur angerissen. Und den titelgebenden Striker könnte man gar aus der Geschichte tilgen, ohne dass es auffiele. Dasselbe gilt auch für andere Figuren, wie N.s Nachbarn oder einen Kampfsport-Schüler, ja auch die Protagonistin selbst bleibt farblos, ihre Biografie – bis auf ein kindliches Schönheitstrauma – schemenhaft. Erratische Formulierungen wie „Schuld daran sind die Phantome, die man auf eine Spiegeloberfläche wirft“ helfen auch nicht weiter.
So wirken die bloß 186 Seiten überfrachtet und inhaltsleer zugleich. Die Erzählerin springt von einer Szene zur nächsten, noch bevor etwas passieren kann.
Man spürt, dass die Autorin mit ihrem Roman einiges an Gesellschaftskritik – über Kapitalismus, Social Media und Wohnungsnot – vermitteln wollte. Darüber tatsächlich nachzudenken, regt „Striker“ allerdings wirklich nicht an.