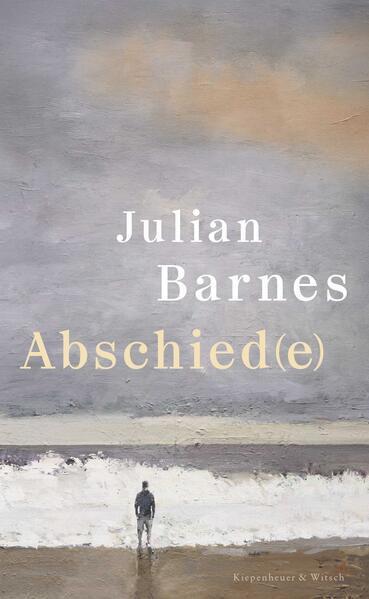Kuchen im Kopf und letzte Worte
in FALTER 1-3/2026 vom 14.01.2026 (S. 31)
Die drei großen Themen der Literatur sind bekanntlich die Liebe, der Tod und die Wapitihirschpirsch bei Rückenwind; und zur Not, so heißt es, könne man eins davon auch auslassen. An diese reduktionistische Maxime hat sich der Brite Julian Barnes, der am 19. Jänner 1946 im englischen Leicester das Licht der Welt erblickte, zeitlebens gehalten. In den rund zwei Dutzend Romanen und Essays, die unter seinem eigenen Namen erschienen sind -eine Handvoll Krimis hat er unter dem Pseudonym Dan Kavanagh veröffentlicht, - findet man nichts zur Wapitijagd, aber jede Menge zu den anderen beiden Themen.
Soeben ist Barnes' jüngstes Buch - in der deutschen Übersetzung übrigens wenige Tage vor dem englischen Original -erschienen, und es überrascht nicht, dass der Autor darin dem Double "Liebe und Tod" treu geblieben ist, zumal der Titel "Abschied(e)" aus guten Gründen eine gewisse Gravitas suggeriert. Als er 2022 mit der Niederschrift begann, wusste der Autor seit zwei Jahren, dass er an Myeloproliferativer Neoplasie erkrankt war. Die Prognose lautete auf "beherrschbar", soll heißen: Er würde wahrscheinlich nicht an, sondern mit dieser seltenen Form von Leukämie sterben.
Bücher britischer Literaten über existenzielle Erfahrungen haben derzeit traurige Konjunktur. Nachdem 2022 ein Messerattentat auf ihn verübt worden war, legte Salman Rushdie in "Knife" (2024) seine "Gedanken nach einem Mordversuch" dar; und im Vorjahr erschien das Memoir "Shattered" (dt.: "Als meine Welt zerbrach"), in dem sich Hanif Kureishi daran erinnert, wie er nach einem Sturz in Rom im Spital landete -und seitdem vom Nacken abwärts gelähmt ist.
Der um neun Jahre ältere Barnes wiederum betrachtet in "Departure(s)" die Hinfälligkeit des Menschen als einen früh einsetzenden Prozess. Seine 2008 an einem Gehirntumor verstorbene Frau Patricia Kavanagh hatte bereits in ihren 50ern ein Tagebuch des körperlichen Verfalls begonnen, er selbst schon davor einen Teil seines Gehörs, später auch noch seinen Geruchssinn verloren.
Der Tod, so schreibt Barnes, sei ihm nicht als letzte Haltestelle am Ende einer Reise erschienen, "ich dachte ihn mir als ständig präsent, auf einem Gleis, das parallel neben meinem Leben herläuft. Und jeden Moment kann er an irgendeiner Weiche unvermittelt abbiegen, mir über den Weg fahren und mich vernichten".
Der finalen physischen Vernichtung geht seit einigen Jahrzehnten immer öfter die Auslöschung der Persönlichkeit durch Demenz voraus, denn: "Erinnerung ist Identität." Dieses -später wieder relativierte -Diktum dient Barnes als Ausgangspunkt einer Reflexion, in der er die berühmte Szene aus Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit", in der eine in Tee getunkte Madeleine die unwillkürliche Erinnerung des Erzählers auslöst, mit aktuellen Einsichten der Neurobiologie kurzschließt.
Referiert wird der Fall eines von einem Schlaganfall im hinteren Thalamus betroffenen Mannes, bei dem der Genuss eines Apfelkuchens eine Kaskade von IAMs (Involuntary Autobiographical Memories) auslöst: Sein Hirn reproduziert die Geschmackserlebnisse sämtlicher Kuchen, die er je gegessen hat. Wobei der systematische Skeptiker Barnes anmerkt, dass niemand überprüfen könne, ob die entsprechenden Sinneseindrücke tatsächlich vollständig und in chronologisch korrekter Reihenfolge abgerufen wurden.
"Abschied(e)" hätte ein autobiografischer Essay über die Krankheit zum Tode werden können. Offenbar wollte es der Autor aber dabei nicht bewenden lassen und auch noch sein anderes großes Thema unterbringen - in Form einer Geschichte, die niemals zu erzählen er seinerzeit den betroffenen Personen geschworen hatte. Nun, da Stephen und Jean tot sind, wähnt er sich berechtigt, sein Gelöbnis zu brechen. Man wünscht, er hätte es eingehalten.
Die Erzählung von der gescheiterten Beziehung zweier Studienfreunde, die - unter Barnes' entscheidender Mithilfe - nach vier Jahrzehnten wieder aufgenommen wird und erneut in die Brüche geht, löst jenes Unbehagen aus, das einen beschleicht, sobald einem intime Details über unbekannte Dritte mitgeteilt werden, die einen eigentlich nichts angehen. Nämliches gilt für die Schuldgefühle und Selbstbezichtigungen, die im Anschluss ausgebreitet werden. Too much information! Es gibt Menschen, die sich überlegen, mit welchem Sager sie aus dieser Welt scheiden wollen. Barnes beteuert, nicht zu ihnen zu gehören. Dennoch legt er mit "Abschied(e)" ein einziges "Was ich noch zu sagen hätte" vor und lässt sich Dinge durchgehen, die er sich früher versagt hätte. Wenn er "das klassische Problem" bei wiederaufgenommenen Liebesbeziehungen im unbewussten Rückfall in alte Verhaltensmuster ausmacht, bedient er sich eines Psychojargons, den ein so souveräner Stilist normalerweise meiden würde wie der Teufel das Weihwasser.
Das Betulich-Vermächtnishafte der mitunter doch recht trivialen Einsichten über "die Liebe" und "das Leben" muss gerade echte Barnes-Fans verstören. Sie können nur hoffen, dass "Abschied(e)" doch noch nicht die letzten Worte gewesen sein werden. Über die Wapitihirschjagd ist jedenfalls noch keineswegs alles gesagt!