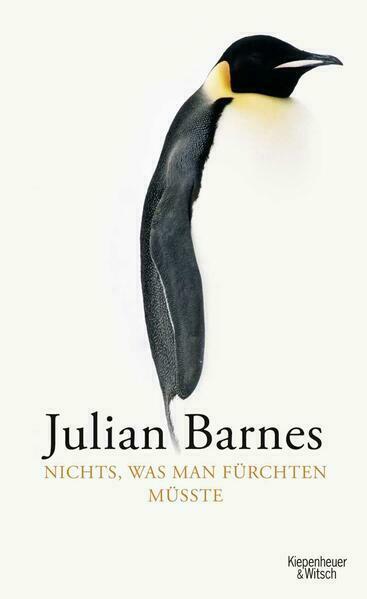Die großen letzten Worte sterben langsam aus
Klaus Nüchtern in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 27)
Julian Barnes hat ein witziges, kluges und gebildetes Buch über den Tod geschrieben – jedenfalls im englischen Original
Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn."
Die meisten Autoren wären froh über eine solche Einstiegspointe. Es wäre nicht Julian Barnes, würde er sich damit zufriedengeben, weswegen er den Satz auch seinem älteren Bruder vorlegt, ohne diesem die Quelle zu verraten. Die trockene Antwort des ehemaligen Universitätsprofessors für Philosophie: "Sentimentaler Quatsch" (im englischen Original: "soppy").
Genau das aber sind Barnes' Reflexionen über die letzten Dinge nicht: Neither soppy nor sloppy machen sie den unermüdlichen Bemühungen des Autors, den Ärmelkanal schreibend zu überbrücken, alle Ehre und verbinden französischen Esprit aufs Selbstverständlichste mit britischer Ironie. Nie stur schematisch sind sie doch von sanfter Systematik insofern, als sie sich – siehe oben – von der lässigen Geste eines Bonmot nicht blenden und davon abhalten lassen, es genauer wissen zu wollen: Verhält es sich tatsächlich so?
Skepsis wird hier einmal nicht als schlampige Haltung (nix Genaues weiß man nicht!) oder als selbstherrlich desillusioniertes Bescheidwissertum, sondern als Modus des Denkens aufgefasst. Im Unterschied etwa zu Siri Hustvedt, die mit ihrem soeben erschienenen Buch "Die zitternde Frau", das ganz ähnliche Themen aufgreift (Autonomie des Subjekts, freier Wille, Natur versus Sozialisation, die ultimative Kränkung durch das Faktum des Todes
), ein vergleichbares Projekt verfolgt, wird dieses Konzept bei Barnes nicht zwanghaft zerebral mit Fallstudien und Forschungsliteratur fortifiziert, sondern mit autobiografischen, geistesgeschichtlichen, poetologischen und zivilisationskritischen Erörterungen zu einem Großessay von beachtlichem Resonanzreichtum verbunden.
Vieles, was über die Ars moriendi im Laufe der Jahrhunderte so zusammengedacht wurde, hält einer näheren Überprüfung nicht stand. Soll man sich etwa seine letzten Worte beizeiten ausdenken (wie es ein Lehrer von Barnes getan hat: "verdammt!")?
Die Chancen, sie rechtzeitig anzubringen, stehen leider nicht besonders: "Die moderne Medizin hat die Sterbephase verlängert und damit die berühmten letzten Worte mehr oder weniger abgeschafft; schließlich hängt alles davon ab, dass der Sprecher weiß, wann der Zeitpunkt für diese Worte gekommen ist."
Und Flauberts Einsicht, dass man alles lernen muss, auch das Sterben? Hm. Die Übungsmöglichkeiten sind hier doch arg beschränkt.
Zusätzlich zu zahlreichen anderen Beispielen (neben Schriftstellerkollegen verschiedener Epochen spielen russische Komponisten des 20. Jahrhunderts eine auffallend prominente Rolle) zitiert Barnes auch den Fall eines Topmanagers, der, unheilbar krank, mit 53 Jahren nur noch drei Monate zu leben hatte und sich – erfolgsorientiert wie eh und je – daran machte, wenigstens den "bestmöglichen Tod" zu sterben.
"Wer die Angst besiegt, der besiegt auch den Tod" wird die Frau des besagten Managers zitiert; Barnes' sanft sarkastischer Kommentar (der in der Übersetzung wirklich seiner entscheidenden Valeurs verlustig geht): "though you don't, of course, end up not dead".
Fragen zu Entscheidungen, die nicht in unserer Hand liegen (lieber bewusst und ein bisschen länger sterben oder doch besser vom Blitz aus heiterem Himmel dahingerafft werden?), und Verhandeln ohne jede Verhandlungsbasis (ewiges Leben im Austausch für Nie-wieder-Schreiben?) zählen zu den von Barnes bevorzugten argumentativen Manövern. Sie sind immer wieder witzig, ironisch, sarkastisch, aber nie kokett. Denn eines bleibt gewiss: Man kann den Tod verdrängen, man kann sich seiner bewusst werden, man kann gegen ihn andenken
– am Ende behält er die Oberhand.
Weswegen Barnes völlig zu Recht die Frage stellt, ob "all this Montaignery" (in der deutschen Ausgabe: "all diese Montaigne'schen Denkmodelle" – arrrrggh!!!), der Versuch also, "sich den Tod wenn nicht zum Freund, so doch wenigstens zum vertrauten Feind zu machen", überhaupt der rechte Weg sei.
Darauf hatte ein berühmter Landsmann von Barnes (denn dieser allerdings nicht erwähnt) schon vor über 200 Jahren eine patente Antwort parat: Als James Boswell wissen will, wie er sich denn "für die Stunde des Todes wappnen" könne, meint Dr. Samuel Johnson: "Nicht doch! Wesentlich ist nicht, wie einer stirbt, sondern wie er lebt. Das Sterben ist belanglos, es dauert ja nur kurz."
Dagegen könnte Julian Barnes eventuell eines seiner zahlreichen "Ja, aber
" in Stellung bringen; seinem Bruder aber bliebe eine Antwort verwehrt: "Sentimentaler Quatsch."